
Liebe Leserinnen und Leser,
Papst Leo XIV und König Charles III. beteten gemeinsam. Das klingt unspektakulär, ist aber ein erstaunliches Ereignis. Erstmals seit etwa 500 Jahren feierten die Oberhäupter der Katholischen und der Anglikanischen Kirchen am 23. Oktober in Rom gemeinsam einen Gottesdienst, als Zeichen für eine Wiederannäherung beider Kirchen. Thema war die Bewahrung der Schöpfung. Das lässt hoffen, dass im Vatikan dieses Thema so wichtig bleibt, wie es für Papst Franziskus war. Vor zehn Jahren hat dieser mit seiner Enzyklika Laudato Si´ vielen Menschen, nicht nur katholischen, einen starken Impuls gegeben, sich für die Schöpfung stark zu machen. In dieser Ausgabe der
BRIEFE stellen die den Umgang und Wirkungen des päpstlichen Wortes in den katholischen Gemeinden in den Mittelpunkt. Mein herzlicher Dank gilt den Autorinnen und Autoren Annegret Rhode, Dr. Wendelin Bücking, Dr. Christoph Arenhövel, Mattias Kiefer, sowie Bernardette Albrecht für die Vermittlung des Beitrages von Nestor Morri aus Argentinien.
In den weißen Seiten stellt Jens Lattke das neu aufgestellte Umweltreferat der EKM vor, dem in Kürze noch eine weitere Mitarbeiterin angehören wird. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen Elan und Freude bei der Arbeit und frohen Mut – ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Kurz berichtet wird über das nun endlich beschlossene Wasserhaushaltsgesetz in Sachsen-Anhalt. Es ändert den Grundsatz für den Umgang mit Niederschlagswasser, weg vom möglichst schnellen Abfluss hin zum Wasserhalt in der Fläche. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Auswirkungen diese Novelle bringen wird.
Ich wünsche Ihnen alles Gute in dieser wirren Zeit und Freude beim Lesen!
Herzlich grüßt
Ihre Siegrun Höhne
Geistliches Wort
FÜR-Bitten1
Gott hat den Himmel und die Erde geschaffen, die Ozeane und das feste Land, Pflanzen, Tiere, Menschen und die Vielfalt der Kleinstlebewesen. Er ist der Urgrund des Lebens. Ihm vertrauen wir unsere Sorgen und Bitten an:
Wir beten für uns und alle, die Verantwortung tragen für unsere Eine Welt, dass wir die Wunder der Schöpfung wahrnehmen und mit Klugheit und Tatkraft dem Leben dienen.
Wir beten für die Pflanzen, besonders für die Feldfrüchte, dass sie nicht zu Opfern gentechnischer Manipulation werden, sondern in ihrer Vielfalt Schätze unseres Lebens sind.
Wir beten für die Nutztiere, dass sie nicht in Tierfabriken ausgebeutet werden, und für die Wildtiere, dass ihre Rückzugsorte erhalten bleiben.
Wir beten für alle Lebensformen und Kulturen, die vor dem Aussterben stehen, dass sich Menschen finden, die für ihre Erhaltung eintreten.
Wir beten für die Menschen in den Küstenregionen, deren Existenz durch den Anstieg der Meere bedroht wird, dass sie gemeinsam nach neuen Wegen suchen, um ihren Lebensunterhalt zu
sichern.
Wir beten für die Wohlhabenden in den großen Städten, dass sie den Armen ihre Lebensmöglichkeiten nicht nehmen, sondern sie einbeziehen in die Entwicklung menschenfreundlicher städtischer Lebensräume.
Gott, du Vater aller Lebewesen, du hast die Erde – unser gemeinsames Haus, den Garten, den du gepflanzt hast – dem Menschen anvertraut, damit er sie bebaue und behüte. Wir haben in Vergangenheit und Gegenwart oft versagt, doch dein Schöpfergeist wirkt in der Welt. Schenke uns Kraft zum Handeln durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
in einer kiste mit muschelschalen
lag er neben dem glasperlenspiel
ganz unscheinbar
doch unverkennbar
ich betrachtete ihn verzückt
dann schob ich das kistchen
zwischen die regale und verließ
laden stadt und land
den weg zurück würd
ich wohl nicht mehr finden
aber freundlich lächle ich
wenn einer seine wahrheit mir
als unumstößlich präsentiert
Charlotte van der Mele (mit freundlicher Genehmigung)
Am Beginn dessen, was wir in Europa Neuzeit nennen, stehen zwei folgenschwere Veränderungen des Weltbezuges – die kopernikanische Revolution des Weltbildes, welches die Erde aus dem Zentrum des Kosmos rückt, und die cartesianische, welche das ICH ins Zentrum stellt. Während also die Erde an den Rand des kosmischen Geschehens versetzt wird, rückt das erkenntnisbegründende ICH in die Mitte und wird zum Ausgang der Welterkenntnis. Nicht mehr Gott, nicht mehr die Dinge sind voraussetzungsloser Punkt der Gewissheit und des Wissens, sondern das denkende ICH. Immerhin bemerkt Descartes, dass ein archimedischer Punkt ihm nicht hilft, um die alte Welt aus den Angeln zu heben. Denn entweder steht er auf diesem Punkt oder er setzt auf ihm seinen Hebel an. Er benötigt einen zweiten objektiv gegebenen Punkt außerhalb des ICH und findet diesen in Gott, der denknotwendig ist, also notwendig sein muss. Auf diesen beiden objektiv gegebenen Punkten baut Descartes ein Weltwissen auf, dass irrtumsfrei ist, solange er seine Zustimmung dem verweigert, was nicht intuitiv evident ist oder sich notwendig ableiten lässt aus dem, was als wahr erkannt wurde.
Immanuel Kant zerstört diese schöne Vorstellung in der Kritik der reinen Vernunft, indem er deutlich macht, dass Gott nicht beweisbar sei (womit er den Atheismus für widerlegt erklärt). Dadurch aber fielen sowohl Gott als auch objektive Erkennbarkeit der Welt aus den Möglichkeiten der Menschen. Wir erkennen die Welt, wie sie für uns, aber nicht, wie sie an sich ist. Damit entlässt Kant uns in die Moderne.
Und hier stehen wir also: Mit einem ungezügelten Subjektivismus und einer objektiv nicht fassbaren Wirklichkeit. Die Idee, dass es keinen objektiven Standpunkt gäbe, hat sich verwandelt in die nunmehr postmoderne Erfahrung, dass jedes ICH seinen objektiven Standpunkt in sich trüge und – so scheint es – diesem unbedingte Geltung verschaffen müsse. War die Moderne noch geprägt von dem Impetus einer kommunikativen Verständigung auf das beste Argument und die Akzeptanz seines zwanglosen Zwanges, stehen wir heute wieder vor der Frage nach der Macht, die eigenen Überzeugungen durchsetzen zu können. Weil es aber keinen objektiven Standpunkt gibt, gibt es keine objektive Möglichkeit, dem ganzen subjektiven Sinn und Unsinn, der sich Bahn bricht, objektiv zu begegnen – das postmoderne Dilemma des anything goes, aus dem wir ohne weiteres nicht herauskommen.
Gibt es einen Ausweg aus dem Fliegenglas? Nun, das erste wäre der Versuch, sich vom Subjektivismus zu verabschieden. Menschen, die ihr Selbst so ernst nehmen, dass sie meinen selbst zu denken, sind natürlich rührend. Aber ihr Selbstdenken ist ja immer wie bei allen Menschen im besten Falle ein Selbstnachdenken. Dann ginge es also darum klarzumachen, welche Grundannahmen und unbegründeten Überzeugungen dem jeweiligen Nachdenken zugrunde liegen, welche Evidenzen diese haben und ob sie für eine gesellschaftliche Praxis normativ gemacht werden sollen. Als zweites wäre mit dem Subjektivismus auch der Objektivismus zu verabschieden. Das Wort objektiv bezeichnet im besten Falle, ob etwas aufgrund geltender Regeln allgemeingültig ist oder nicht. Diese Regeln unterscheiden sich, weil es natürlich auch keine objektiven Regeln für alles gibt. Wittgenstein spricht von Sprachspielen oder alternativ von Lebenswelten. Was bei Schach objektiv gilt, gilt nicht bei Skat – wie der Schachkönig ja auch ganz anderen Regeln folgt als der König beim Skat. In gleicher Weise sind die Objektivitäten der Wissenschaften nur eine der Regeln, die gerade gelten. Sie beschreiben nicht, wie es objektiv ist, sondern was objektiv als Methoden einer wissenschaftlichen Wissensgewinnung anerkannt ist. Objektiv notwendige Folgen aus diesen Erkenntnissen für ein gesellschaftliches Leben gehören nicht dazu. Das wäre dann wieder ein anderes Sprachspiel. Und Wissenschaften sind Konventionen. Es ist denkbar, dass andere Methoden zu wesentlich besseren und genaueren Abbildungen der Wirklichkeit führen – die heute aber als unwissenschaftlich gelten.
Was für die Wissenschaften spricht und dafür, ihre Ergebnisse als Grundlage gesellschaftlicher Praxis zu beachten, ist die Transparenz ihres Methodenkastens und ihre Evidenz, die sich aus der Überprüfbarkeit dieser Ergebnisse ergibt. Aber auch das macht sie nicht objektiv an sich. Sie haben keinen Anspruch auf begründungslose Umsetzung in gesellschaftliche Regeln. Sie haben jedoch wirklich sehr starke Argumente, die von denen, die sie ablehnen, erst einmal widerlegt werden müssten, wenn diese ihre Überzeugungen normativ machen wollen.
Und damit sind wir bei dem Punkt, der das Wort objektiv so problematisch macht. Verbunden mit der Idee der Objektivität ist die Idee der Macht. Wenn Descartes Gott als objektiven Punkt seiner gesamten Wirklichkeitskonstruktion wählt, wählt er die Macht schlechthin – und im Umkehrschluss bekommt die Idee der Objektivität quasi eine göttliche Qualität. Wenn Kant nun aber die Idee der göttlichen Objektivität aus den Möglichkeiten des Menschen im Blick auf die reine Vernunft ausschließt, schließt er in gewisser Weise die Möglichkeit der Objektivität aus (Objektiv sind nur noch die Strukturen menschlicher Erkenntnismöglichkeiten). Er versetzt dann jedoch die Erkenntnis Gottes in den Bereich der praktischen Vernunft. Ohne das weiter auszuführen – das wäre dann der Ort des Glaubens.
Gott sichert keine Objektivität, aber SIE bedingt mich. Ist Grund meines Lebens und meiner Überzeugungen und meiner Haltung. Die ich nicht begründen kann. Die ich daher auch nicht zum Maßstab machen kann. Aber die ich erklären – bezeugen – leben kann. Und die dann im besten Falle auch überzeugend ist. Damit wird sie zu einer Absage an Macht und an Durchsetzbarkeit. Aber nicht in einem passiven Sinne, sondern als radikal kritische Infragestellung aller, die präfaktisch, faktisch oder postfaktisch argumentieren, um eigene — und zwar nicht nur religiöse, sondern auch gesellschaftliche — Ansprüche durchzusetzen.
Was das im Einzelnen heißt, ließe sich an Beispielen diskutieren: Coronaleugnung, Kapitalismus, Asylpolitik, Patriotismus, oder Wissenschaften und ihre Inanspruchnahme für irgendwelche Thesen. Und das Ganze mit einem Lächeln für all die, die alles ganz genau wissen.
Zum Autor:
Paul F. Martin ist Studienleiter für Theologie, Gesellschaft und Kultur
an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg.
Kontakt: martin@ev-akademie-wittenberg.de
1 Gottesdienstbausteine zur Enzyklika „Laudato Si’“ von Papst Franziskus
Petra Gaidetzka, MISEREOR
www.misereor.de/fileadmin/user_upload/Infothek/gottesdienstbausteine-zur-enzyklika-laudato-si.pdf
Aus den Kirchen
von Jens Lattke
Die Umweltarbeit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ist in den vergangenen Monaten neu aufgestellt und personell verstärkt worden. Ziel ist es, dem kirchlichen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung noch besser und engagierter nachzukommen.
Wie eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise konkret aussehen kann, soll im Dialog erarbeitet werden. Dazu sind Diskussionen und Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen unserer Landeskirche notwendig – vor allem in den Bereichen Gebäude, Beschaffung, Mobilität, Landnutzung, Ernährung und Artenvielfalt. Hier entstehen Veränderungsprozesse, die sich an den lokalen Gegebenheiten und jeweiligen Möglichkeiten orientieren.
Das Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum begleitet diesen Weg. Sein Fachbereich Umwelt berät Christinnen und Christen bei ihrem Engagement, unterstützt Gemeinden in Bildungsarbeit und Projekten und fördert den gesellschaftlichen Dialog. Dazu gehört die fachliche Begleitung bei Planung und Umsetzung von Vorhaben – sei es bei Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Projekten zur Artenförderung, Schöpfungsgottesdiensten oder Umweltaktionstagen.
Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Kirche
Ein entscheidender Schritt ist die Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die EKM. Dieses soll bestehende Aktivitäten bündeln und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der gesamten Landeskirche verankern. Im Zentrum stehen dabei die Bereiche Gebäude, Mobilität und Beschaffung.
Die Ziele sind ambitioniert: Bis 2035 sollen die Treibhausgas-Emissionen um 90 Prozent reduziert werden. Spätestens 2045 will die EKM Netto-Treibhausgasneutralität erreichen. Grundlage ist die Überzeugung, dass Gott den Menschen mit der Erde ein wertvolles Gut anvertraut hat – verbunden mit der Verantwortung, sorgsam und nachhaltig mit ihr umzugehen.
Der Fachbereich Umwelt im Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum wird derzeit von drei Personen getragen:
- Jens Lattke ist Diakon und leitet den Fachbereich. Er studierte unter anderem Umweltbildung und Umweltwissenschaften. Im Team verantwortet er insbesondere die Themen Schöpfungstheologie, Dialog über Umwelt- und Klimafragen, Konfliktbearbeitung und Klimagerechtigkeit.
- Anja Lindholm-Eriksen verstärkt das Team als Klimaschutzmanagerin. Ihre beruflichen Erfahrungen basieren vor allem auf der Schnittmenge von Projektmanagement, Kommunikation und Marketing. Während des Masterstudiums verknüpfte sie ihre betriebs-wirtschaftlichen Kenntnisse mit Nachhaltigkeit. Zuletzt lag ihr Fokus auf Klimaschutzkommunikation.
- Andreas Teich war nach verschiedenen beruflichen Stationen zuletzt als Ingenieur im Fachbereich Energie, Innovation und Umwelt in Magdeburg tätig. Dort hat er Unternehmen und kommunale Akteure zu Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien beraten. Diese Erfahrungen bringt er nun gezielt in die kirchliche Klimaschutzarbeit, wobei ihm die Verbindung von technischer Wirksamkeit und gesellschaftlicher Teilhabe besonders wichtig ist.
Im November 2025 wird noch eine Umweltreferentin zum Team dazukommen. Sie wird insbesondere die Arbeit in den Themenbereichen Biodiversität, Mobilität und Bildung unterstützen.
Mit dieser personellen und inhaltlichen Stärkung setzt die EKM ein klares Zeichen: Klimaschutz und christliche Schöpfungsverantwortung werden gemeinsam gestaltet.
Der Autor ist Landeskirchlicher Beauftragter für Friedens- und Umweltarbeit der EKM
Tel.: 0391 – 53 46 399
E-Mail:
www.oekumenezentrum-ekm.de
Save the Date!
Schöpfungsfest der EKM
Im nächsten Jahr wird wieder der Umweltpreis der EKM vergeben. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, gemeinsam mit Euch ein großes und fröhliches Schöpfungsfest zu feiern. Sehr gern seid ihr zur Mitwirkung eingeladen. Nur gemeinsam wird es ein Fest, das ermutigt und unser breites Umweltengagement strahlen lässt.
Datum: 12. September 2026, 10 – 17 Uhr
Ort: Lutherstadt Wittenberg
Wir planen ein Fest mit Musik, Workshop- und Gesprächsangeboten, ein Podiumsgespräch, Gottesdienst und die Verleihung des Umweltpreises der EKM.
Es soll vielfältige Möglichkeiten der Mitwirkung, der Präsentation und des Austausches geben.
Es ist wunderbar, wenn Ihr mit einem Mitmachangebot, einer Aktion, einem Stand, einer interaktiven Führung, einer Lesung, Musik, oder … dabei seid.
Im Namen des Vorbereitungsteams
Jens Lattke
von Heiko Reinhold

Zu einer Party der anderen Art hatte die Volkshochschule Mittelsachsen gemeinsam mit der Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien (VEE) nach Grünlichtenberg (Mittelsachsen) eingeladen. Fast 40 Interessierte trafen sich Ende September auf einem Vierseithof mit mehreren Mietwohnungen, der im Zuge einer Altbau-Sanierung auch energetisch aufgewertet wurde.
Ähnliche „Solar-Partys“ veranstaltet die VEE sachsenweit seit mehreren Jahren. Im Fokus stehen praktische und individuelle Lösungen der Sektorenkopplung. In Grünlichtenberg sind das PV-Anlagen mit Speichermöglichkeiten und intelligenter Steuerung, Wärmepumpen mit Tiefenbohrung, Elektroautos mit gemeinschaftlich genutzter Wallbox.
Auch andere „Energie-Freaks“ stellten ihre Projekte vor. Ein echter „Hingucker“ war der alte Trabant P600, der schon seit vielen Jahren als Elektroauto zugelassen ist. Erstmals wurde auch eine umgebaute Schwalbe gezeigt, die ebenfalls rein elektrisch angetrieben wird und Vater und Sohn gleichermaßen begeistert.
Mehrere Kurzvorträge von Ökostrom über die politische Lage bis zu Bürgerenergie motivierten die Gäste zu einem regen Austausch bei reichlich vorhandener Verpflegung. Die Besichtigung des Hofes und der Fahrzeuge zeigte noch einmal die hohe Kompetenz und Eigeninitiative der Besitzer. Viele Anlagen wurden immer weiterentwickelt und optimiert. Angesichts der zunehmenden „Dagegen“-Bewegungen war es erfreulich, viele „Macher“ kennenzulernen, die die Möglichkeiten einer modernen Energieversorgung kreativ nutzen und ihre Erfahrungen gern weitergeben.
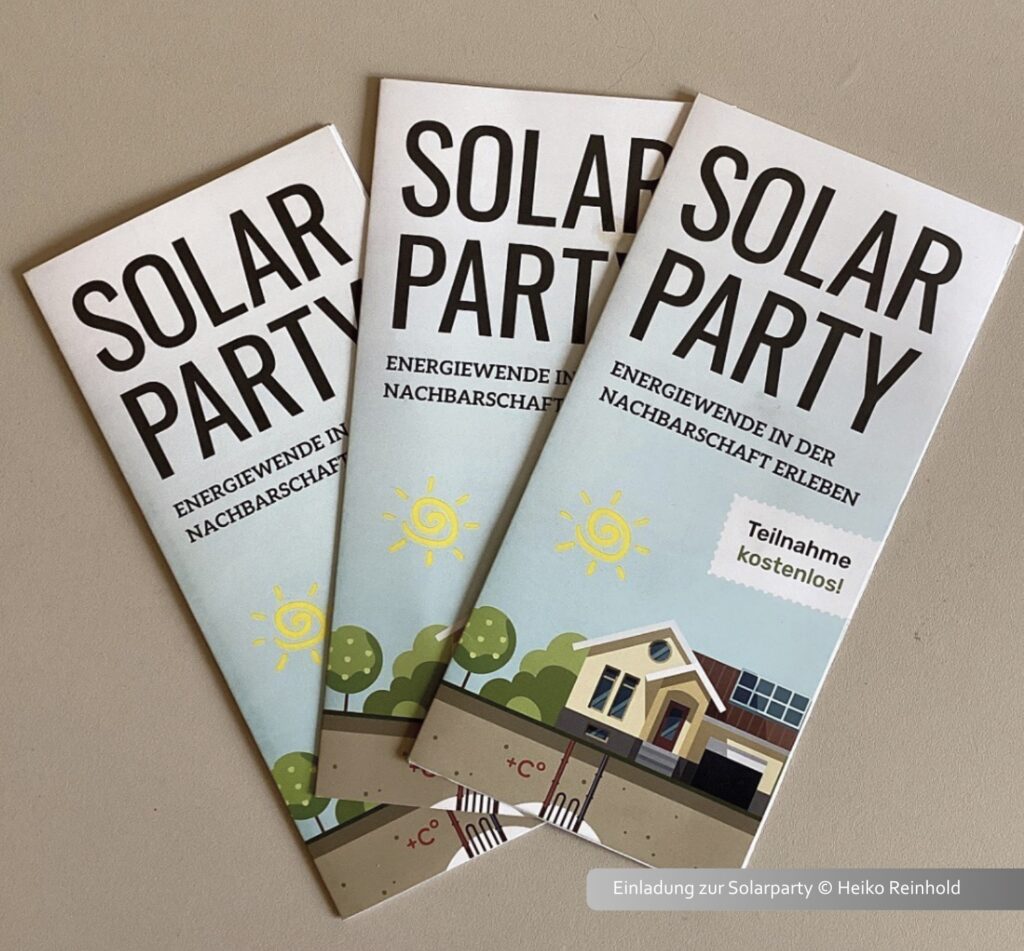
Ähnlich wie die Solar-Party funktioniert auch der jährliche Praxistag der Sächsischen Energieagentur SAENA, der sich speziell an Kirchgemeinden richtet. Hier liegt ein großes Potenzial, um sich Ideen und Beratung für die Gebäudenutzung und den energetischen Umbau zu holen – auch zum Nutzen des Gemeindehaushalts.
Der Autor Heiko Reinhold ist Projektleiter politische und ökologische Bildung an der Volkshochschule Mittelsachsen
Tel.: 03431 6073850
E-Mail:
www.vhs-mittelsachsen.de/politik-umwelt
Siehe auch
www.vee-sachsen.de/solar-party
www.saena.de/veranstaltungsdetails.php?id=1657
PM: Berlin, 23. September 2025
Anlässlich des Erntedankfestes (5. Oktober) hat heute ein Bündnis aus kirchlichen Entwicklungsorganisationen und bäuerlichen Interessenvertretungen eine Erntekrone an Bärbel Kofler überreicht. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erhält die Krone mit der Bitte, sich für den Schutz der Saatgutvielfalt einzusetzen. Das Bündnis fordert zudem, keine Patente auf Saatgut zuzulassen.
Die Erntekrone steht für die Dankbarkeit gegenüber der Natur, für Wertschätzung bäuerlicher Arbeit und für eine gute Ernte. Diese ist für bäuerliche Betriebe in Deutschland und weltweit immer schwieriger zu erzielen. Klimaveränderungen bringen Wetterextreme, und große Agrarkonzerne gewinnen durch Patente immer mehr Kontrolle über den Saatgutmarkt. Vielfältiges, lokal angepasstes Saatgut steht immer weniger zur Verfügung, und der Zugang wird immer mehr eingeschränkt. Zudem plant die EU-Kommission, das EU-Gentechnikrecht erheblich aufzuweichen, sodass eine gentechnikfreie Saatgut- und Lebensmittelerzeugung nicht mehr möglich sein wird.
„Wenn neue Gentechnik in der EU kaum noch geprüft und gekennzeichnet wird, wenn Pflanzen patentiert werden können und wenige Konzerne das Saatgut kontrollieren, verlieren Bäuerinnen und Bauern in Europa und weltweit die Kontrolle darüber, was sie anbauen“, beschreibt Kathrin Schroeder, Abteilungsleiterin Politik und globale Zukunftsfragen bei Misereor die Situation. „Sie können dann nicht mehr frei entscheiden, ob eine Sorte zum Boden oder Klima passt. Weniger Auswahl auf dem Feld bedeutet weniger Sicherheit auf dem Teller: Wenn alle das Gleiche anbauen, kann eine Krankheit ganze Ernten vernichten – und das betrifft am Ende uns alle.“
In dieser Legislaturperiode stehen in der EU und im Bundestag wichtige Entscheidungen an. Es wird mit Hochdruck über die Reform der EU-Saatgutverordnung und an einem Verordnungsentwurf zu neuen Gentechnik-Pflanzen verhandelt. Diese Prozesse entscheiden darüber, ob bäuerliche Rechte gestärkt oder weiter eingeschränkt werden. Das Bündnis fordert, die „UN-Erklärung über die Rechte von Bäuerinnen und Bauern“ (UNDROP) von 2018 zur Grundlage der Gesetzgebungen zu machen und bäuerliche Rechte zu schützen!
„Wir fordern die Bundesregierung auf, sich in Brüssel für klare Regeln einzusetzen: Saatgut muss für Bäuerinnen und Bauern frei zugänglich und tauschbar bleiben, nur so bleibt die Vielfalt erhalten,“ erklärt Claudia Gerster, Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V. und Bäuerin aus Sachsen-Anhalt. „Gentechnikfreie konventionelle und ökologische Landwirtschaft braucht Schutz durch verpflichtende, wirksame Koexistenz- und Haftungsregelungen. Das wertvolle EU-Vorsorgeprinzip und unsere Wahlfreiheit als Bäuerinnen, Bauern und Verbraucher*innen muss gewährleistet werden.“
Wichtig sei es, dass regional und global zusammen gedacht wird, für Ernährungssouveränität und Vielfalt weltweit. Dazu Martin Krieg, Direktor für Kommunikation und Engagement bei Brot für die Welt: „Saatgut gehört allen – es ist nicht das Eigentum weniger. Wenn große Konzerne Patente auf Pflanzen erteilt bekommen, dürfen andere das Saatgut oft nicht mehr verwenden oder weiterentwickeln. Das ist, als würde jemand das Rezept für Brot patentieren und anderen verbieten, es zu backen.“
In einem gemeinsamen Papier, das die Bündnispartner Staatssekretärin Bärbel Kofler überreichten, haben die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Brot für die Welt, Misereor, die Interessengemeinschaft Nachbau, die Katholische Landvolkbewegung Deutschland und die Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in den Gliedkirchen der EKD sieben zentrale Empfehlungen zusammengefasst. Diese zeigen, warum Saatgutpolitik heute über Ernährungssicherheit entscheidet.
Kontakt:
Annemarie Volling
Gentechnik-Referentin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V.
Mobil: 0160 96760146
Bettina Locklair
Bundesgeschäftsführerin der KLB Deutschland
Mobil: 0170 4636 898
Nina Brodbeck
Pressestelle Misereor Berlin
Mobil: 0170 5746417
Prokop Bowtromiuk
Pressesprecher Brot für die Welt
Tel.: 030 65211 1599
Aus der Politik
von Siegrun Höhne
Am 11. September 2025 verabschiedete der Landtag von Sachsen-Anhalt das „Gesetz zur Verbesserung des Wassermanagements“. Ziel der Novellierung ist eine Anpassung an Veränderungen im Wasserdargebot infolge der Klimaveränderungen.
In der Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt heißt es: „Ein sinkendes Wasserdargebot, regional heftiger Starkregen sowie längere Hitze- und Trockenperioden erfordern Anpassungen bei der Bewirtschaftung der Gewässer. Stand bislang ausschließlich der schnelle Abfluss von Wasser im Fokus, soll künftig deutlich größeres Augenmerk auf den Wasserrückhalt in der Fläche gelegt werden. Geeignete Maßnahmen dafür sind zum Beispiel das Anlegen von Sohlgleiten, weniger Krautungen oder die Reaktivierung vorhandener Stauanlagen. Zur öffentlich-rechtlichen Verpflichtung der Gewässerunterhaltung soll künftig auch die Rückhaltung von Wasser gehören. Dadurch entstehen den Unterhaltungsverpflichteten erhebliche zusätzliche Aufgaben, etwa durch Reaktivierung von Stauanlagen, Einbau von Kies und Totholz oder Einrichtung von Erosionsschutzstreifen.“1
Eine Experimentierklausel ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die Erprobung (zeitlich befristeter) Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung, die zu verbesserten Abfluss- oder Rückhaltungsverhältnissen führen, jedoch rechtlich nicht unter Vorgaben der Gewässerunterhaltung fallen (§ 54a). Die Versickerung von Niederschlagswasser hat künftig Vorrang vor dessen Einleitung (§§ 29 Abs. 1 und 78a).
Die umweltpolitische Sprecherin Sandra Hietel-Heuer der CDU-Fraktion im Landtag erklärte hierzu: „Mit diesem Gesetz agieren wir und stellen uns den Realitäten, während andere den Klimawandel weiter leugnen. Es geht nicht um Symbolpolitik, sondern darum, unsere Wasserressourcen langfristig zu sichern. Wir verankern den Vorrang der Trinkwasserversorgung und werden zugleich den Bedürfnissen von Wirtschaft und Landwirtschaft gerecht, wenn wir den Fokus auf den Wasserrückhalt in der Fläche legen. Zentral ist die Abkehr von der einseitigen Wasserableitung hin zum aktiven Wassermanagement: stabile Wasserhaushalte sichern nicht nur die Nachfrage von Industrie und Landwirtschaft, sondern stärken zugleich den Naturschutz. Ein wichtiges Signal senden wir auch an unsere Waldbesitzer. Ihre Wälder speichern Wasser für uns alle – deshalb werden sie künftig stärker von den Beiträgen zur Unterhaltung der Gewässer entlastet.“2
Aus der Pressestelle der Grünen heißt es: „Das neue Wassergesetz ist ein überfälliger, aber richtiger Schritt. Damit Sachsen-Anhalt Vorbild für nachhaltiges Wassermanagement wird, braucht es jedoch mehr als diesen Anfang – es braucht den politischen Willen, mutig nachzusteuern, wenn die Praxis es erfordert.“ Wolfgang Aldag, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion sagte: „Die Zeit hat gezeigt, wie dringend wir diesen gesetzlichen Rahmen brauchen. Umso mehr begrüßen wir, dass zentrale grüne Anliegen nun Eingang gefunden haben – etwa der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung und die Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Das neue Gesetz erkennt diese Realität an.“
Beschlossen wurde es mit den Stimmen von CDU, SPD und den Grünen. Die AfD stimmte dagegen, die Linken haben sich enthalten.
1 https://mwu.sachsen-anhalt.de/umwelt/wasser/wassergesetz#c428451
2 www.cdufraktion.de/2025/neues-wassergesetz-verabschiedet/
(Vor-)Lesetipp
Zwei Stinktiere streiten sich, wer von beiden wohl am besten stinken könne. „Ich“, sagt das eine, „ich stinke, dass es den Häusern die Dächer abhebt.“ „Ich“, spricht das zweite, „ich stinke, dass es allen Tieren den Pelz umdreht.“ „Ach du“, sagt das erste, „du riechst so angenehm, dass dich die Menschen bald zu Parfüm verarbeiten werden!“ „Und du erst“, erwidert das zweite, „du duftest, dass sie dich demnächst statt Blumen in ihre Zimmer stellen!“ „Du solltest lieber ordentlich stinken, statt hier herumzustänkern!“ „Und du Stinkstiefel könntest dir mal die Nase putzen, damit du merkst, wie ekelig frisch du riechst!“ Sie streiten eifrig. Jedes versucht nach Kräften, seinen üblen Geruch zu verbreiten. Das eine, bis sich die Grashalme biegen. Das andere, bis sich der Wald blau zu färben beginnt. Schließlich stinkt es so gewaltig, dass beide nicht mehr merken, wer abscheulicher modert. Sie beschließen: Der Erstbeste, der vorbeikommt, soll ihren Streit schlichten. Aber es kommt niemand.
Die Fortsetzung folgt:
„Prima, wenn keiner in der Nähe ist, kann ich endlich in aller Ruhe meine Bücher lesen“ sagt das Stinktier Eins. Und war bald so ins Lesen vertieft, das es vergaß, weiter zu stänkern.
„Mist“, sagte das zweite und begann aus Langeweile Stinktier Eins zu beschimpfen. „Du Duftling. Warmduscher. Deospraybenutzer. Gutriecher.“ Dann fielen ihm keine Schimpfworte mehr ein. „Wozu ist das Internet da,“ dachte sich Stinktier Zwei und setzte sich an den geruchsunempfindlichen Computer, um neue stinktiertaugliche Schimpfworte zu erfahren. Beide vergaßen ihren Streit und das Stänkern.
In dem Moment spazierte eine Menschengruppe mit Atemschutzmasken vorbei. Denn der außerordentliche Gestank hatte sich herumgesprochen, der Wald war berühmt geworden. Da es kein Duftfernsehen gab, zogen die Menschen vom Parkplatz mit einem Reiseführer los, um die Tiere zu sehen. Der Stinktierwald wurde zur Sperrzone erklärt und der Bürgermeister des nächsten Ortes kassierte hohe Eintrittsgebühren. Wenn er genug eingesammelt hatte, wollte er den Wald abholzen und eine Mülldeponie errichten.
Das las Stinktier Zwei im Internet und sprang sofort auf – so rasch eben ein Stinktier aufspringen kann. Es war empört, hüpfte auf die Menschgruppe zu und redete auf diese ein. Sie sollten gegen den Bürgermeister unbedingt was unternehmen.
Die hörten nicht, was es sagte, wegen der Gasmasken. „Das will einen Kontakt, ich bin kein Feigling – ich stelle mich dem Gestank!“, rief ein besonders mutiger Mensch, der ohnehin gerade Nasenverstopfung hatte. Gegen den Protest seines Reiseleiters riss er sich die Maske vom Kopf und – roch normale Waldluft.
Das Stinktier wunderte sich, wie leicht Menschen ihre Köpfe auswechseln können.
Der Mann rief: „Betrug, es stinkt gar nicht, ich will mein Geld zurück, Schweinerei.“
„Eine Mülldeponie ist wirklich Müll“, erläuterte das Stinktier, „und der Bürgermeister sagt, aus den Einnahmen würde er ein Denkmal bauen lassen, das an die ausgestorbenen Tiere unserer Welt erinnern soll…“
Weiter kam es nicht. Die Menschen rissen um die Wette ihre Atemschutzmasken vom Kopf und schrieen: „Betrug, Prozess, Verbraucherschutz, Klage.“
„Hört doch mal, das Tier kann reden“, sprach der Reiseführer verwundert.
Aber die Leute rannten zurück, um die Einlass-Kasse zu stürmen. „Wir haben nicht für sprechende Stinktiere bezahlt, sondern für stinkende!“
„Das könnt ihr haben!“, meinte das nun wieder wütende Tier. Waren Menschen so blöd oder taten sie nur so? Es stank mit allen ihm zur Verfügung stehenden Drüsen.
Da rannte der Reisegruppennichtmehrführer auch weg. „Es stinkt! Es stinkt wieder!“ rief er der Gruppe hinterher.
Die Besucher fuhren längst nach Hause oder telefonierten wegen Schadenersatzklagen mit ihren Anwälten. Einer schlief vor Erschöpfung auf der Bank vor der Einlass-Kasse ein und schnarchte. Das tat er melodisch nach zwei beliebten Melodien: die eine, wenn er auf der rechten Seite lag – die andere, wenn er auf der linken schlief.
Einen Schnarch-Musiker hatte die Welt noch nicht gesehen, immer mehr Menschen versammelten sich um die Bank und schunkelten zur Melodie eines bekannten Volksliedes mit. Das schnarchte er ziemlich flott auf seiner linken Seite.
Der Bürgermeister lief mit der Spendenbüchse unter den Gästen umher, die Stinktiere schienen vergessen. Die Menschen bekamen Lust mitzusingen oder mitzuschlafen, sie legten sich nieder, schnarchten oder summten im Schlaf oder nur mit geschlossenen Augen. Einige träumten sich in ein prächtiges Konzert hinein, die Instrumente der Musiker waren ihre Nasen und Münder und – oh, oh, bei einigen kamen auch Laute aus dem hinteren Bereich der unteren Körperhälfte eines Menschen dazu. Da, wo es manchmal knarrt und quietscht und es einem meist peinlich ist, wenn sich dieser Geräuschemacher meldete. Nicht so in diesem Konzert, es war allen eine Freude allen zuzuhören oder lieber gleich mitzumachen.
„Ist was, ich höre Musik?“ fragte Stinktier Nummer Eins seinen Kumpan.
„Nein, gar nichts“, spottete der.
„Dann ist es ja gut, ich kann weiterlesen“, meinte Nummer Eins, „ich habe hier ein Buch mit einer Geschichte entdeckt, die von zwei Stinktieren handelt. Die wollen um die Wette stinken. Mal sehen, wie es weitergeht.“
Die aktuelle Ausgabe ist vergriffen, das Buch kann aber als E-Book erworben werden (Kanon-Verlag).
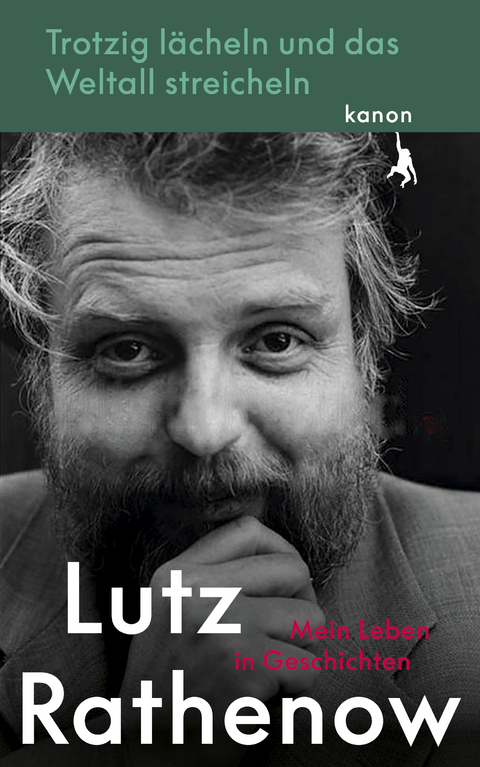
272 Seiten
Preis: 24,00 €
ISBN 978-3-98568-050-4
Veranstaltungstipp
Lesung und Gespräch mit Fabian Scheidler
Am 6. Dezember 2025, 18 Uhr,
in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg, Schloßplatz 1d
Zum aktuellen Buch heißt es auf der Verlagsseite:
Seit Jahren bewegt sich die westliche Welt in Richtung eines permanenten Ausnahmezustandes. Auf jede neue Krise, auf jeden Konflikt reagiert die Politik mit drakonischen Maßnahmen und zunehmender Militarisierung. In seinem neuen Buch warnt Fabian Scheidler, Autor des internationalen Bestsellers „Das Ende der Megamaschine“, dass dieser Weg in eine Spirale von ökonomischem Niedergang, politischem Chaos und Krieg führt. Grundlegende demokratische und soziale Errungenschaften drohen einer als alternativlos dargestellten militärischen Logik geopfert zu werden. Der Wohlfahrtsstaat mutiert zum Kriegsstaat.
Scheidler deutet den Ausnahmezustand als Versuch, die sich zuspitzenden globalen Krisen autoritär zu beherrschen. Dabei zeigt er, wie die Feinde, die bekämpft werden sollen, zu einem großen Teil durch die Politik selbst geschaffen werden. Die Verweigerung von Diplomatie schafft Kriegsanlässe, so wie Anti-Terror-Kriege immer neue Terroristen hervorbringen.
Doch der Abstieg in die selbstzerstörerische Kriegslogik ist keineswegs alternativlos. Angesichts der Gefahren, die mit den weltpolitischen Umbrüchen, der Zerstörung der Biosphäre und der Aushöhlung der Demokratie verbunden sind, weist das Buch neue Wege zum Umgang mit den Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Westliche Gesellschaften müssen lernen, sich von ihrer jahrhundertelangen Politik der Dominanz zu verabschieden, um eine Kultur der Kooperation zu entwickeln.
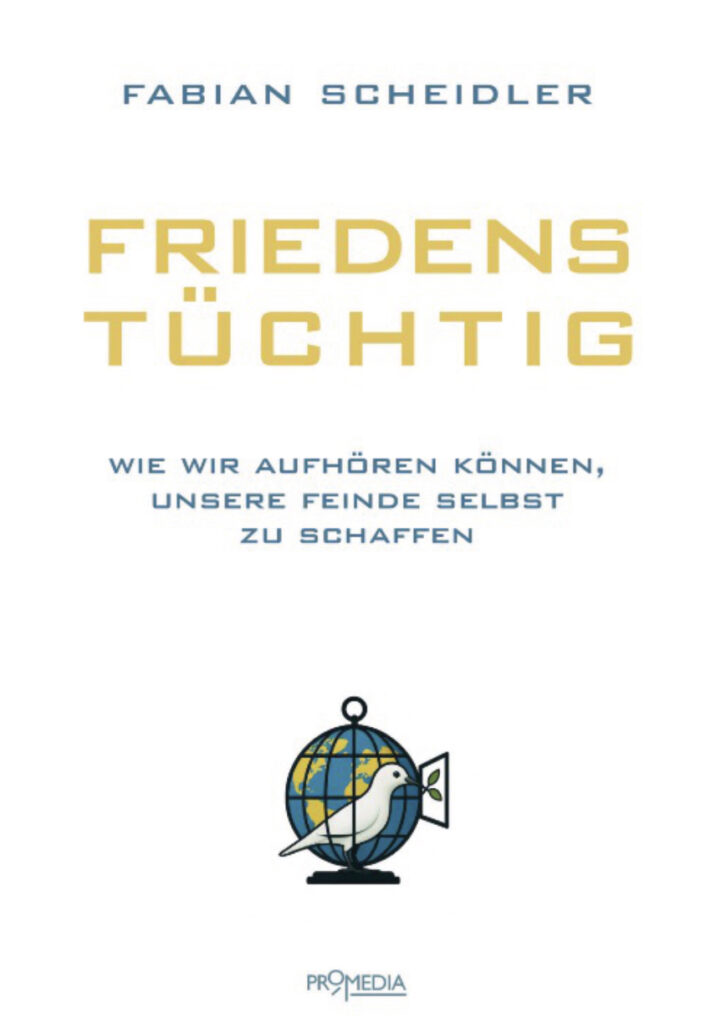
224 Seiten
Preis: 20,00 €
ISBN: 978-3-85371-549-9
E-Book: 14,99 €
ISBN: 978-3-85371-934-3
Themenseiten – 10 Jahre Laudato Si’
ein Meilenstein in der kirchlichen Umweltbewegung
von Dr. Wendelin Bücking
Ich kann mich noch gut erinnern, wie die katholischen Umweltbeauftragten im Jahr 2015 zur Jahrestagung zusammensaßen, und sich fragten, was da jetzt wohl kommen wird, als eine neue umfassende Umweltenzyklika angekündigt wurde. Zu sehr waren die meisten vom Frust des Nicht-Handelns und Nicht-Erreichens in der katholischen Umweltarbeit belastet, als dass die Erwartungen allzu groß gewesen wären.
Umso mehr waren alle überrascht, was dann kam – es hat alle Erwartungen übertroffen! Ich halte die Enzyklika Laudato si‘ für einen der wertvollsten Beiträge in den letzten 10 Jahren. Wichtig ist vor allem der umfassende Blick auf das Thema, in dem auch unbequeme Wahrheiten in den Blick genommen werden, es geht darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, so sind die Adressaten auch ausdrücklich „alle Menschen guten Willens“, und es ist die Verbindung zur Spiritualität, die ja schon im Titel aufgenommen wird. Man könnte diesen Punkt vielleicht auch als „mentale Nachhaltigkeit“ betrachten. Alle diese Punkte zeigen, dass Franziskus ein großer Papst war, der die Menschen wieder in den Mittelpunkt gerückt und vor allem auch die Not der sozial-schwachen nicht aus dem Blick verloren hat. An dieser Stelle soll nochmal ausdrücklich sein Lebenswerk gewürdigt werden, das ja weit über die Enzyklika Laudato si‘ hinausgeht, nicht nur in der Nachfolgeenzyklika „Fratelli tutti“, sondern auch in vielen unkonventionellen Gesten, die ihn authentisch und überzeugend wirken ließen.
An vielen Stellen wurden die Inhalte der Enzyklika aufgenommen, im Bistum Erfurt hat sich beispielsweise im Katholikenrat eine Arbeitsgruppe Laudato si gebildet, über die sie in diesem Heft lesen können. Auf der Ebene der deutschen Bischofskonferenz hat man sich dagegen mit dem Thema schwergetan, und es hat doch immerhin 5 Jahre gedauert, bis sich die Bischofskonferenz zur Veröffentlichung eines Flyers über 10 Handlungsempfehlungen „Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag“ durchgerungen hat. Der Inhalt und eine Ergänzung durch praktische Beispiele in einer Veröffentlichung des Bistums Erfurt finden sich hier in den gelben Seiten.
Es wird eine theologische Reflexion und einen umfassenden Blick der Wirkung der Enzyklika auf die Weltkirche geben. Darüber hinaus wird die „Laudato si‘-action-Plattform vorgestellt, eine Möglichkeit im Sinne von Laudato si‘ vor Ort ins Handeln zu kommen.
Und direkt hatte die Enzyklika Laudato si‘ nach ihrer Veröffentlichung auch eine Wirkung auf die Klimakonferenz in Paris, die kurz danach stattfand. So finden sich heute viele Elemente in den „For-Future-Gruppen“, insbesondere bei „Churches for Future“, aber auch „Christians for Future“, die neue „Graswurzel-Umweltbewegungen“ der Kirchen darstellen. Da die amtskirchlichen Strukturen mitunter langsam mahlen, sind diese Gruppen und ihre Bestärkung auch durch die Enzyklika umso wichtiger.
Ich wünsche Ihnen gute Anregungen beim Lesen des Heftes und es ist ganz im Sinne von Papst Franziskus, sich weiterhin aktiv und engagiert für das Thema einzusetzen und die Hoffnung nicht aufzugeben.
Der Autor ist Umweltbeauftragter des Bistums Magdeburg.
Die Enzyklika Laudato Si’
von Mattias Kiefer
Die Trauer um den Tod Papst Franziskus‘ fällt in diesen Tagen zusammen mit der Erinnerung an seine bahnbrechende erste eigene Enzyklika „Laudato Si‘. Über die Sorge für das gemeinsame Haus“, die vor ziemlich genau zehn Jahren am 24.5.2015 veröffentlicht wurde.
Ziel(gruppe) und Grundlagen der Enzyklika
Sehr vieles an dieser Enzyklika war ungewohnt, war neu: Sie verstand sich zwar auch, aber eben nicht ausschließlich als Lehr- und Mahnschreiben eines Papstes an Katholik:innen, sondern vielmehr als Dialogangebot an „alle Menschen, die auf diesem Planeten leben“ (LS 3). Auch deshalb ist sie in einem allgemein verständlichen Stil gehalten, die Erfahrungen der Ortskirchen weltweit kommen sehr prominent und zahlreich vor, sie zitiert eine ganze Reihe auch nicht-katholischer Autoren, und nicht zuletzt erfährt auch die säkulare Umweltbewegung eine mehrfache Würdigung. Ihre Ausgangspunkte sind die konkrete Empirie – sie ist (natur)wissenschaftlich auf Höhe der aktuellen Fachdiskussion (dafür haben prominent zugearbeitet u.a. Wissenschaftler:innen vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) – und die Lebenswelt der vielen Menschen „am Rand“, deren Erfahrungen (befreiungs)theologisch gedeutet werden: Natur ist „Mutter Erde“, es geht um „buen vivir“, also ein gutes Leben für alle, …; damit hat der Text eine durchgängig „doppelte (natur)wissenschaftlich und theologisch-religiöse Codierung“ (Ch. Bals). Die spirituellen Traditionen des abendländischen Christentums werden verwoben mit lateinamerikanischer Weisheit, Motive franziskanischer und ignatianischer Spiritualität verbunden mit vielen ökumenischen Impulsen aus der Orthodoxie. Es entstehen „Modulationen der Verkündigung“ (M. Heimbach-Steins): prophetische Anklage, eindringlicher Appell, ermutigende Hoffnungszusage, hochgestimmtes Lob.
Zentrale Themen der Enzyklika
Die inhaltlich roten Linien, die sich durch den gesamten Text ziehen (vgl. LS 15), sind
- die enge Beziehung zwischen den Armen und der Anfälligkeit des Planeten, anders gesagt, die Verschränkung von Armuts- mit der Gerechtigkeits- und Umweltfrage;
- die tiefe Überzeugung, dass in der Welt alles miteinander verbunden ist, weshalb es einer ganzheitlichen Sicht auf die Wirklichkeit bedarf;
- die Kritik am sog. „despotischen Anthropozentrismus“ als Ausdruck menschlicher Selbstüberschätzung und am „technokratischen Paradigma“ als Formen von gewinngeleiteter, technikbasierter Machtausübung über andere;
- aus einer deutlichen Wachstums- und Systemkritik heraus die Suche nach einem anderen Verständnis von Wirtschaft und Fortschritt;
- die Betonung des Eigenwerts eines jeden Geschöpfs;
- der Vorschlag eines neuen Lebensstils statt der vorherrschenden Wegwerfkultur;
sowie die Forderung nach einer „ökologischen Umkehr“, getragen von einer „ökologischen Spiritualität“.
Theologiegeschichtlicher Einschnitt
Eine theologiegeschichtliche Zäsur bedeutet die Forderung von Papst Franziskus, den sog. Herrschaftsauftrag des „macht Euch die Erde untertan“ (Gen 1,28) zu lesen und zu interpretieren von Gen 2,15 her, also mit der Perspektive des sog. Hege- und Pflegeauftrags an den Menschen (vgl. LS 67). „Laudato Si‘“ ist damit auch eine späte Antwort auf Autoren wie Lynn White und Carl Améry, die in den 1960er und 1970er wirkmächtig von der ökologischen Krise als „gnadenlose Folge des Christentums“ geschrieben hatten. Zentrale ethische Argumente der Enzyklika sind das vom Papst prominent „wiederentdeckte“ Gemeinwohlprinzip und die Würde jedes/r Einzelnen: „Darum reicht es nicht mehr zu sagen, dass wir uns um die zukünftigen Generationen sorgen müssen. Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere eigene Würde auf dem Spiel steht.“ (LS 160) Der beschriebene „neue Lebensstil“ in Solidarität mit der geschundenen Kreatur wird motiviert, getragen und genährt durch eine Spiritualität, die „nicht von der Leiblichkeit, noch von der Natur oder den Wirklichkeiten dieser Welt getrennt ist, sondern damit und darin gelebt wird, in Gemeinschaft mit allem, was uns umgibt.“ (LS 216)
Inner- und Außerkirchliche Nachwirkungen der Enzyklika
Die Enzyklika hat vor zehn Jahren inner- wie außerkirchlich ein gewaltiges Echo ausgelöst, deren Wiederklänge wir heute noch hören, und sie hat maßgeblich die politische Entscheidungsfindung speziell auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris mitbeeinflusst: Ihre zentrale Einsicht „Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle.“ (LS 23) wurde mit dem Pariser Klimaabkommen völkerrechtlich festgeschrieben. Ihre Aussagen zum Wert jedes Geschöpfs waren für Christ:innen in Bayern eine wesentliche Motivation, das Artenschutzvolksbegehren 2019 zu unterstützen. Auch in Bezug auf die eigene kirchliche Praxis, auch in unserer Erzdiözese, hat die Enzyklika vieles angestoßen, erleichtert und möglich gemacht – und Wunden konnten heilen, die viele christlich Mitwelt-Engagierte der ersten Generation auch durch ihre eigene Kirche erleiden mussten. Auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz wurden 2018 zehn sog. „Handlungsempfehlungen zu Ökologie und nachhaltiger Entwicklung“ als praktischer Umsetzungsleitfaden zur Enzyklika veröffentlicht, deren eine Blaupause die Münchner Diözesanen Nachhaltigkeitsleitlinien waren, bereits im März 2015, also sogar noch vor der Enzyklika, vom damaligen Generalvikar Beer in Kraft gesetzt.
Aktualität der Aussagen auch nach 10 Jahren
Viele der Aussagen und Appelle der Enzyklika „Laudato Si‘“ haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, im Gegenteil: Die globale Erderhitzung und das sechste Arten-Massensterben der Erdgeschichte schreiten ungebremst voran, zudem erlebt die Welt die Wiederkehr nationalistisch-spalterisch-asozial-demokratiezerstörerischen Gedankenguts in noch bis vor kurzem unvorstellbarem Ausmaß. Dem hält die Enzyklika eindringlich entgegen: Hört die Schreie der Armen und des Planeten! – sie müssen auch Euch interessieren, weil alles auf dieser Erde mit allem verbunden ist. Erst Frieden in den Beziehungen zu Euren Mitmenschen, den Pflanzen und Tieren als Euren Mitgeschöpfen, und in der Beziehung zu Gott führen zu innerem Frieden mit Euch selbst. Werdet aktiv, handelt, betet – und vergesst dabei über aller Sorge und allem Kampf das Singen nicht.
Oder, in den Worten Kardinal Czernys, Leiter des Vatikan-Dikasteriums für die ganzheitliche menschliche Entwicklung: „In the context of the Jubilee of Hope 2025, this tenth anniversary will be a time to celebrate what has been achieved and to give thanks to God. A time to promote the encyclical among Catholics and people of all faiths who do not know it. A time to mourn – and struggle – with those who suffer, marginalised or impoverished, because of the damage inflicted on the Earth and unjust economic mechanisms.”
Der Autor ist Leiter der Abteilung Umwelt der Erzdiözese München und Freising sowie Sprecher der AG der Umweltbeauftragten der deutschen (Erz)Bistümer (AGU)
„Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen?“ (LS 160)
von Dr. Christoph Arenhövel
Vorbemerkung:
Worte wie diese haben mich sehr berührt, als ich die Enzyklika „Laudato si´“ von Papst Franziskus zum ersten Mal im Urlaub 2015 auf einer Reise durch Schweden gelesen habe. Da meine Frau und ich drei Kinder und sieben Enkel haben, machen wir uns angesichts des Zustands der Welt große Sorgen um ihre Zukunft!
Als Biologe habe ich lange im Umwelt- und Naturschutz arbeiten können. Deshalb ist mir die vom Papst dargestellte Problemlage, „was unserem Haus (der Erde) widerfährt“ (LS 17-61), sehr vertraut: die Umweltverschmutzung, der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und andere Probleme. Aus den Notizen, die ich mir zur Umweltenzyklika gemacht hatte, entstanden Vorträge, die ich in Kirchengemeinden, bei ökumenischen Treffen und für kirchliche Verbände gehalten habe. Mir war es wichtig, dieses Lehrschreiben des Papstes bekannter zu machen und zum Handeln für die Schöpfung zu werben.
Beitrag der Arbeitsgruppe „Laudato si´“ des Katholikenrates im Bistum Erfurt:
Am 4. November 2016 brachte ich auf der Herbstversammlung des Katholikenrates ein Impulspapier ein. Darin habe ich angeregt, dass sich alle Pfarrgemeinden mit der Enzyklika „Laudato si´“ befassen sollten. Denn wir Christen müssen uns noch stärker als bisher für die Bewahrung der Schöpfung engagieren. Das gilt heute umso mehr, wo weltweit die Klima- und die Biodiversitätskrise voranschreiten, Umweltstandards abgebaut werden und im Regierungshandeln die Umwelt- und Entwicklungspolitik weit nach hinten gerückt ist. Hier müssen die Kirchen ein Zeichen setzen!
In seiner Enzyklika ermutigt uns Papst Franziskus: „Gehen wir singend voran! Mögen unsere Kämpfe und Sorgen um diesen Planeten uns nicht die Freude und die Hoffnung nehmen. … Im Herzen dieser Welt ist der Herr des Lebens … gegenwärtig. Er verlässt uns nicht, er lässt uns nicht allein, denn er hat sich endgültig mit unserer Erde verbunden, und seine Liebe führt uns immer dazu, neue Wege zu finden.“ (LS 244/245)
Als Reaktion auf dieses Impulspapier bildete sich auf der Herbstversammlung 2016 des Katholikenrates eine Arbeitsgruppe, die den Namen „Laudato si´“ übernahm. Ich wurde gebeten, die Leitung der Gruppe als Sprecher zu übernehmen.
Die Arbeitsgruppe verfasste als Erstes einen Aufruf an alle katholischen Gemeinden, sich in der Schöpfungszeit (1. September bis 4. Oktober) an der Feier von „ökumenischen Schöpfungsgottesdiensten“ zu beteiligen. Hierfür hatte sich Papst Franziskus im Jahr 2015 ausdrücklich ausgesprochen.
Für die Gestaltung von Schöpfungsgottesdiensten erarbeitete die Arbeitsgruppe einen Vorschlag, der im Amtsblatt des Bistums und auf der Homepage veröffentlicht wurde. Nach und nach beteiligen sich immer mehr Kirchengemeinden an der Feier von Schöpfungsgottesdiensten; im Jahr 2025 waren es im Bistum Erfurt 8 Gemeinden.
Meine Heimatpfarrei „Herz Jesu Weimar“, feierte 2025 zum 9. Mal solch einen Schöpfungsgottesdienst. Er fand im ehemaligen Klostergarten in Oberweimar statt und wurde mit Chormusik und Posaunenchor gestaltet. Manchmal wurden diese Feiern zur Pflanzung eines Baumes genutzt, so z. B. 2023 im Pfarrgarten in Weimar und 2024 in der Stadt Bad Berka.

Ein Höhepunkt war der „Schöpfungstag“ auf dem Hülfensberg/Eichsfeld (25.6.2021), bei dem das Bistumsprojekt „öko+fair vor Ort“ gestartet wurde.

Hülfensberg im Eichsfeld wurde das Bistumsprojekt
„öko+fair vor Ort“ gestartet
(im Bild: Bischof Dr. Ulrich Neymeyr)
Auch der Schöpfungstag auf der Bundesgartenschau in Erfurt (1.9.2021) stellte einen Höhepunkt dar. Bei beiden Schöpfungstagen konnten wir die Öffentlichkeit über die Arbeit der Arbeitsgruppe „Laudato si´“ unterrichten.
Ein Hauptanliegen der AG „Laudato si´“ war die Erstellung der 40-seitigen Broschüre „Gottes gute Schöpfung feiern und bewahren! Empfehlungen des Katholikenrates für nachhaltiges, ökologisches und faires Handeln im Bistum Erfurt“. Mit der Arbeit daran wurde 2017 begonnen. Ausgehend von der Enzyklika werden darin 10 Themenfelder vorgeschlagen, wie das kirchliche Handeln noch stärker mit globaler Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung in Einklang gebracht werden kann.
Als im Herbst 2018 die Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Titel „Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag. Handlungsempfehlungen zu Ökologie und nachhaltiger Entwicklung für die deutschen (Erz-)Diözesen“ erschien, richtete die Erfurter Arbeitsgruppe die Gliederung ihrer Broschüre danach aus.
Unsere Handlungsempfehlung wurde im Jahr 2020 fertig gestellt, mit Vorworten von Bischof Dr. Ulrich Neymeyr und dem damaligen Vorsitzenden des Katholikenrates, Thomas Kretschmer. Die Broschüre wurde allen Pfarreien sowie den kirchlichen Verbänden und Institutionen des Bistums zugeschickt und ans Herz gelegt. Da die Handlungsempfehlung über die Bistumsgrenzen hinaus auf Interesse stieß, wurde angeregt, sie bundesweit zur Nutzung im Pfarrbriefservice anzubieten. Die Arbeitsgruppe erarbeitete mit Unterstützung der Pressestelle dazu 20 Einzelbeiträge.
Für den Katholikentag, der 2024 in Erfurt stattfand, wurde die Handlungsempfehlung in einer 2., überarbeiteten und erweiterten Auflage herausgegeben. Sie ist auf der Homepage des Bistums unter folgendem Link zu finden:
https://www.bistum-erfurt.de/bildung_kultur_engagement/schoepfungsbewahrung
Als das Bistum Erfurt im Jahr 2020 seine Arbeit am Projekt „öko+fair vor Ort“ begann, erhielt ich als Vertreter der AG „Laudato si´“ die Möglichkeit, in der Projektgruppe mitzuarbeiten. Welches Anliegen dieses Bistumsprojekt verfolgt und welche Dynamik es in den zurückliegenden 5 Jahren entfaltet hat, wird im folgenden Beitrag von der Koordinatorin des Projektes, Annegret Rhode, dargestellt.

am 25.9.2022 mit Testen des eigenen
ökologischen Fußabdrucks
Auch die Pfarrei „Herz Jesu Weimar“ hat sich an diesem Projekt beteiligt und sich zur Einhaltung bestimmter ökologischer und sozial-fairer Kriterien verpflichtet. Zum Beispiel werden bei Pfarrfesten Waren aus dem Weltladen und Honig angeboten, der aus den Bienenbeuten im Pfarrgarten stammt und den schönen Namen „Die fromme Süße“ trägt. Beim „Kirchenkaffee“ wird „fairer“ Kaffee und Tee ausgeschenkt.
Die Pfarrfeste werden auch genutzt, die Gemeindeglieder spielerisch an ökologische Fragen heranzuführen, z. B. mit: „Teste deinen eigenen ökologischen Fußabdruck!“ Oder: „Erzeuge mit 6 Fahrrädern die nötige Energie, um Kaffee zu kochen!“
Im Jahr 2023 konnte die Pfarrei „Herz Jesu Weimar“ im Rahmen des Schöpfungs-Gottesdienstes als erste Pfarrei im Bistum mit dem Label „öko+faire Gemeinde“ ausgezeichnet werden.
Am 7. März 2020 unterstützte die Arbeitsgruppe „Laudato si´“ die Ausrichtung des Ökumenischen Umweltfachtages, der jedes Jahr durch die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt und das Bistum Magdeburg in Mitteldeutschland veranstaltet wird. Der Fachtag fand in der Pfarrei „Herz Jesu Weimar“ statt und stand unter dem Motto „Zehn Prozent Wildnis!“. Die rund 50 Tagungsteilnehmer beschäftigten sich mit der Frage, inwieweit die Kirchen in ihren Pfarr- und Kindergärten, Seniorenheimen, auf Friedhöfen und auf verpachtetem Kirchenland zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen können. Mit naturnahen Pflanzungen (blütenreichen Kräutern und Sträuchern, Obstbäumen, Hecken) und dem Zulassen von „Wildnis“-Flächen können die Kirchen einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten. Außerdem bieten kirchliche Gebäude oft Nistgelegenheiten oder Quartiere für gefährdete Tierarten (Vögel, Fledermäuse). Darauf weist die Aktion „Lebensraum Kirchturm“ (NABU) hin.
Im Nachgang erstellte die AG zum Thema „Zehn Prozent Wildnis!“ ein Poster und Flyer, mit denen bei der Standbetreuung auf der Bundesgartenschau 2021 und beim Katholikentag 2024 in Erfurt Tipps zur Förderung der Biodiversität auf kirchlichen Liegenschaften gegeben wurden. Solche Anregungen finden sich auch im Kapitel 8 der „Handlungsempfehlungen“ des Katholikenrates.
Als Vertreter des Bistums nahm ich am 1. Juni 2022 an einem Workshop zur Fortschreibung der Biodiversitätsstrategie für Thüringen teil. Auf dieser Tagung stellte Ralf Demmerle (NABU) das Projekt „Fairpachten“ vor (vgl. „Briefe“ Heft 146, S. 7ff.). Es verfolgt das Anliegen, beim Abschluss neuer Pachtverträge von Kirchen stärker als bisher auf ökologische Aspekte zu achten und diese vertraglich zu verankern. Im Ergebnis eines Beratungsprozesses, den die AG „Laudato si´“ mit der Abteilung Recht/Liegenschaften des bischöflichen Ordinariats geführt hat, wurde ein neuer landwirtschaftlicher Musterpachtvertrag erarbeitet. Dieser gibt dem Pächter ökologische Vorgaben an die Hand und löst den bisherigen Pachtvertrag ab. Beim Abschließen neuer Pachtverträge wird dieser Vertrag inzwischen angewendet.
Ein Mitglied der Arbeitsgruppe „Laudato si´“ hat darüber hinaus angeregt, von einem Kirchenwald bei Brehme (Eichsfeld) eine Parzelle für das Artenschutzprojekt „LuchsWald“ des NABU zur Verfügung zu stellen.
Über das Gesagte hinaus nutzte die Arbeitsgruppe „Laudato si´“ Möglichkeiten, um das Anliegen der Schöpfungsbewahrung öffentlich zu machen, z. B. in einem Bistums-Podcast, in Radio-Interviews und in der MDR- Serie „Glaubwürdig“. Gemeinsam mit dem Umweltbeauftragten des Bistums Magdeburg, Dr. Bücking, wurden für die Artikelserie „Die Schöpfung – uns anvertraut“ im „Tag des Herrn“, der Zeitschrift für die ostdeutschen Bistümer, praktische Anregungen gegeben.
Beim diesjährigen Schöpfungsgottesdienst in Weimar wurde sowohl an das 800jährige Bestehen des „Sonnengesangs“ von Franz von Assisi erinnert als auch an die Veröffentlichung der Umweltenzyklika „Laudato si´“ von Papst Franziskus. Auch 10 Jahre danach sind diese Worte von Papst Franziskus nach wie vor aktuell:
„Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird als eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam, und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens.“ (LS 207)
Der Autor Dr. Christoph Arenhövel ist Sprecher der Arbeitsgruppe „Laudato si´“
vom Katholikenrat im Bistum Erfurt
„Gottes gute Schöpfung feiern und bewahren!“
von Dr. Christoph Arenhövel (Federführung), Dirk Adams, Ordinariatsrat Dr. Claudio Kullmann, Gundela Otto,
Niklas Wagner
Im Vorwort der im Herbst 2018 von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Arbeitshilfe „Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag – Handlungsempfehlungen zu Ökologie und nachhaltiger Entwicklung für die deutschen (Erz-)Diözesen“ heißt es: „Daraus erwächst die Forderung an uns alle, mehr Verantwortung für Ökologie und nachhaltige Entwicklung zu übernehmen.“ Die zehn Handlungsempfehlungen der Arbeitshilfe betreffen die Pastoral, das kirchliche Verwaltungshandeln und das gesellschaftliche Engagement für die Schöpfungsbewahrung.
Die Bischöfe verpflichten sich, „regelmäßig über den jeweiligen Stand des Schöpfungsengagements in ihren Diözesen (zu) berichten, um darüber zu reflektieren, (sich) anzuspornen und noch besser zu werden.“ Nach drei Jahren wird ein erster Bericht vorgelegt. „Indem die Kirche auch in ihrem eigenen Handeln Schöpfungsverantwortung übernimmt, setzt sie ein wichtiges Zeichen.“
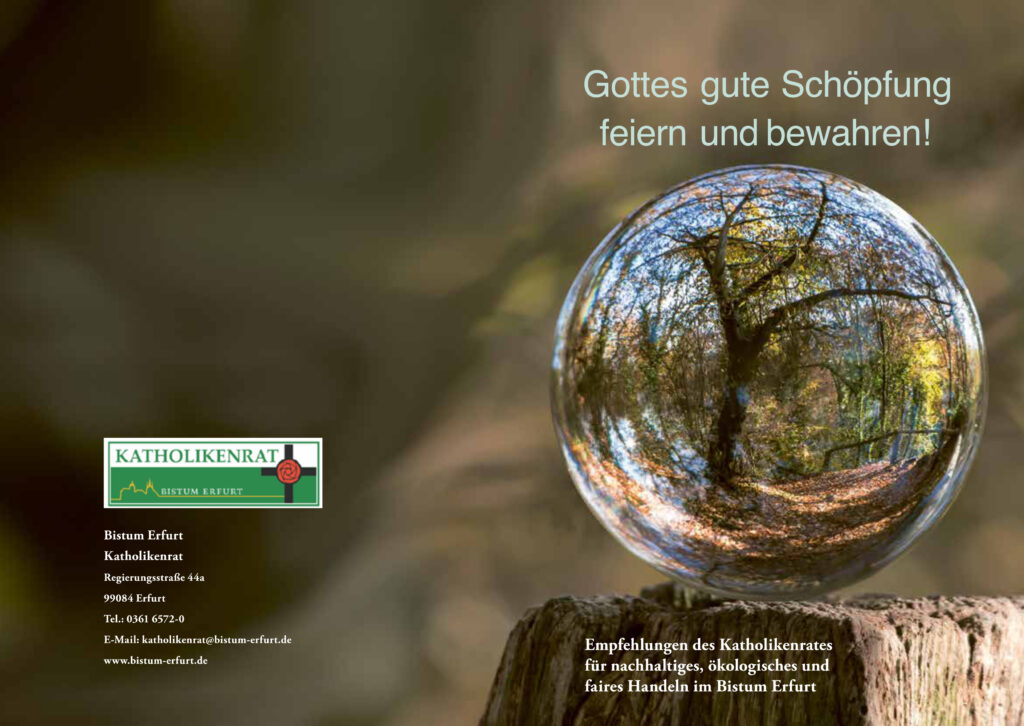
Im Jahr 2021 wurde ein erster Klima- und Umweltschutzbericht hierzu vorgelegt. Dieser offenbarte bei den einzelnen Diözesen einen sehr unterschiedlichen Stand zu ihrem Schöpfungsengagement. Daraus ergeben sich noch große Herausforderungen, um z. B. das Ziel der Klimaneutralität oder andere Fortschritte beim Umwelt- und Biodiversitätsschutz zu erreichen.
Im Bistum Erfurt wurde dieser Impuls aufgenommen. Mit seiner vorgelegten Broschüre „Gottes gute Schöpfung feiern und bewahren!“ möchte der Katholikenrat des Bistums Erfurt alle Pfarrgemeinden und Institutionen des Bistums ermutigen, auf dem Weg der Schöpfungsbewahrung voranzuschreiten und die bereits begonnenen Schritte zum nachhaltigen, ökologisch-fairen Handeln weiterzuverfolgen. Jesu Auftrag an uns, die Zeichen der Zeit zu erkennen und danach zu handeln, ist für den Fortbestand unseres Planeten dringlich geworden. Zugleich möchte der Katholikenrat mit der Arbeitsgruppe „Laudato si´“ das Engagement des kirchlichen Umweltbeauftragten unseres Bistums für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit unterstützen.
Anm. d. Red.: Die sehr ansprechende und klug gestaltete Broschüre ist beim Autor und unter
www.bistum-erfurt.de/fileadmin
erhältlich. Hier sind die behandelten 10 Themenfelder gekürzt abgedruckt:
1. Schöpfungsspiritualität in Verkündigung und Liturgie verorten
Gott hat uns Menschen seine Schöpfung anvertraut, damit wir sie hüten und bebauen (vgl. Genesis 1 und 2). Der Schöpfer vertraut uns und erwartet, dass wir sorgsam mit seinen Geschöpfen umgehen. Die aktuellen globalen Umweltprobleme wie der Klimawandel mit seinen verheerenden Folgen, das dramatische Aussterben vieler Pflanzen- und Tierarten und die Plastik-Vermüllung der Meere mahnen uns, umzudenken, umzukehren und verantwortungsvoll zu handeln!
Die Freude über Gottes Schöpfung, aber auch die Sorge um ihre Bewahrung sind keine Selbstverständlichkeit. Es gilt, sie stärker als bisher in das kirchliche Leben zu integrieren. Auch hier gilt der Auftrag Jesu, die Zeichen der Zeit zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Angesichts der weltweiten Umweltprobleme müssen wir Christen uns bewusst machen, dass wir eine große Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung und der Lebensgrundlagen weltweit haben, für die Menschen auf allen Erdteilen, vor allem in den ärmeren Regionen, aber auch für die Generationen, die nach uns leben wollen.
Der Katholikenrat im Bistum Erfurt möchte dazu anregen, künftig die Schöpfungsspiritualität zu einem Schwerpunkt der Verkündigung zu machen. Der Auftrag Gottes an uns Menschen, seine Schöpfung zu hüten, zu pflegen und zu bewahren, sollte als existentielle Aufgabe mehr als bisher in unseren Gottesdiensten angesprochen werden, zum Beispiel in der Predigt, in den Fürbitten oder bei der Auswahl der Lieder.
Feier des Weltgebetstages für die Schöpfung
Der Katholikenrat im Bistum Erfurt ruft unsere Kirchengemeinden dazu auf, in der Zeit zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober (dem Gedenktag des hl. Franz von Assisi) einen Schöpfungsgottesdienst zu feiern. Wenn möglich, sollte dieser ökumenisch vorbereitet und begangen werden. Die Arbeitsgruppe „Laudato si´“ des Katholikenrates hat einen Vorschlag zur Gestaltung dieses Gottesdienstes erarbeitet, der im „Amtsblatt für das Bistum Erfurt“ Nr. 6/2017 vom 20.06.2017 als Anlage veröffentlicht wurde (er ist auch unter www.bistum-erfurt.de abrufbar). Dieser Gestaltungsvorschlag ist als Anregung zu verstehen. Er kann nach den Gegebenheiten des Ortes modifiziert werden und sollte auch aktuelle Entwicklungen einbeziehen.
Alljährlich gibt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ein „Gottesdienst- und Materialheft zum ökumenischen Tag der Schöpfung“ heraus. Dieses Heft kann gedruckt bezogen oder digital heruntergeladen werden (www.schoepfungstag.info).
Mit der Anregung zur Feier eines eigenen Schöpfungsgottesdienstes griff Papst Franziskus im Jahr 2015 eine Initiative der orthodoxen Kirche auf, der sich die ACK angeschlossen hat. Der Termin kann frei gewählt werden. Besonders bietet sich der 1. September als Weltgebetstag für die Schöpfung der katholischen Kirche oder der erste Freitag im September an, wie es die ACK vorschlägt.
Das Erntedankfest bewusst feiern
Am ersten Sonntag im Oktober wird in vielen Gemeinden unseres Bistums das Erntedankfest gefeiert. Zumeist wird der Altarraum mit Feldfrüchten und Blumen festlich geschmückt, häufig gibt es einen besonders gestalteten Gottesdienst. Das Erntedankfest ist besonders geeignet, um die Anliegen des Umweltschutzes zu thematisieren und erlebbar zu machen. Dabei sollte es natürlich zunächst darum gehen, dankbar zu sein für die Schönheit und den Ertrag unserer Natur.
Vielleicht kündigen Sie vor dem Sommer einen Fotowettbewerb an – im Rahmen des Gottesdienstes an Erntedank werden die schönsten „Erntebilder“ der Gemeindemitglieder präsentiert. Oder die Gemeinde verarbeitet den Kirchenschmuck nach dem Gottesdienst gemeinsam zu einem leckeren Gemüsegericht. Solche anderen Zugänge zum Erntedankfest können helfen, unsere Lebensmittel neu und wertschätzend in den Blick zu nehmen.
Eine andere Idee ist, den Kirchenschmuck zum Erntedankfest einmal kritisch in den Blick zu nehmen. Die oft wunderschön arrangierten saisonalen Früchte unserer Region sind ja in der Regel nicht die Lebensmittel, von denen wir uns vorrangig ernähren. Wir haben uns selbstverständlich daran gewöhnt, dass wir zu jeder Jahreszeit beinahe alle Sorten Obst und Gemüse verfügbar haben. Erdbeeren im Oktober, frischer Spargel auch außerhalb der Saison, Avocados, Kiwis und Ananas – stets gut und günstig. Dass diese Früchte oft schon eine halbe Weltreise hinter sich haben und noch dazu im Anbauland häufig unter schlechten Bedingungen für Mensch und Umwelt produziert werden, darüber machen wir uns nur selten Gedanken. Vielleicht ist das Erntedankfest dann auch eine Gelegenheit, Südfrüchte und andere weit gereiste Kostbarkeiten trotz ihrer Verfügbarkeit wieder als etwas Besonderes wahrzunehmen, das man bewusst genießen sollte.
2. Schöpfungsbewusstsein innerkirchlich verankern
Wie wird die Kirche von morgen aussehen? Sicherlich deutlich anders als heute. Die katholische Kirche steht vor großen Herausforderungen und Veränderungsprozessen. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt kontinuierlich, ebenso geht die Zahl der aktiven Priester stark zurück.
Das Bistum Erfurt reagiert darauf mit der weiteren Anpassung der pastoralen Strukturen und der Bildung größerer Pfarreien. Aber auch jenseits der strukturellen Fragen stellen viele die überkommenen Prinzipien und so manche Lehrmeinung infrage. Bei all diesen Veränderungen ist es vielleicht verständlich, dass das Thema „Schöpfungsbewusstsein“ bei vielen in der Kirche nicht unbedingt die oberste Priorität hat.
Umso erfreulicher war es, dass bei den vom Seelsorgeamt des Bistums Erfurt im Frühjahr 2019 veranstalteten Pastoraltagen zur Zukunftsgestaltung unseres Bistums auch das Thema Umweltschutz als wichtiges Arbeitsfeld benannt wurde. Auch die Bewahrung der Schöpfung ist eine drängende Zukunftsfrage unserer Kirche. Wie die deutschen Bischöfe betonen, wird es für die Zukunft entscheidend sein, in der alltäglichen kirchlichen Praxis Klimaschutz in seinen vielen Facetten von der Ausnahme zur Regel zu machen. Wenn es gelingt, die Kirche zu einem glaubwürdigen Akteur in Sachen Klimaschutz zu entwickeln, kann sie in einer Welt, die angesichts der „ächzenden Mutter Erde“ zunehmend die Hoffnung zu verlieren droht, neue Hoffnung stiften.
Weltkirchliche Partnerschaften pflegen – Eine-Welt-Verkauf
Katholisch bedeutet „die ganze Erde umfassend“. Wir sind eingebunden in eine Weltkirche mit sehr unterschiedlichen Kulturen und Lebensverhältnissen. Der gemeinsame Glaube und die Zugehörigkeit zu der einen Kirche bilden eine gute Basis für eine Begegnung auf Augenhöhe. Partnerschaften mit Katholikinnen und Katholiken aus anderen Erdteilen bereichern das eigene Glaubensleben und machen bewusst, dass wir viele Möglichkeiten haben, die Nöte anderer zu lindern.
Oft entstehen diese Nöte auch aus Umweltproblemen heraus. Beispielsweise ist die fortschreitende Zerstörung des tropischen Regenwaldes in Südamerika nicht nur für das Weltklima insgesamt eine Katastrophe, sondern sie bringt der einheimischen Bevölkerung auch nur sehr kurzfristig eine wirtschaftliche Lebensgrundlage. Nach nur wenigen Jahren haben sich die neuen „Ackerflächen“ unumkehrbar in öde Wüstenlandschaften verwandelt.
Auch die internationalen Handelsbeziehungen machen vielen Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika zu schaffen. Wenn z. B. Kaffee, Kakao und Tee hierzulande günstig angeboten werden können, zahlen den eigentlichen Preis die Erzeuger vor Ort. Mit dem Kauf von „fair gehandelten“ Produkten, die es mittlerweile in jedem Supermarkt gibt, können Sie ohne viel Aufwand dazu beitragen, ungerechte Strukturen abzubauen. Achten Sie auf das Fairtrade-Siegel. Es garantiert den Bauern stabile Abnahmepreise und Prämien für Gemeinschaftsprojekte.
Im Bistum Erfurt gibt es in einigen Gemeinden langjährige Partnerschaften in Länder des globalen Südens. Auch die Einladung eines Gastes im Rahmen der jährlichen Spendenaktionen der kirchlichen Hilfswerke „Adveniat“, „Misereor“ und „Missio“ kann bereichernd sein. Oder Sie organisieren nach dem Sonntagsgottesdienst einmal einen Eine-Welt-Verkauf.
Aktionen für Kinder planen
Wie lebt ein 10-jähriger Junge in einer brasilianischen Großstadt? Warum besitzt ein 7-jähriges Mädchen in Burkina Faso schon eine eigene Kuh? Kinder kann man leicht für das Leben anderer Kinder in anderen Ländern interessieren. Dabei wird ihnen schnell bewusst, wie bedroht die Lebensgrundlagen ihrer Altersgenossen in vielen Ländern sind: Mangelhafter Zugang zu sauberem Wasser, schlechte Ernährungssituation, erschwerter Zugang zu medizinischer Versorgung und Schulbildung.
Es ist für die Kinder in unseren Gemeinden eine wichtige Erfahrung der Wirksamkeit von Glaube und Kirche, wenn sie spüren: Ich kann hier vor Ort in meiner Kirchengemeinde direkt etwas für ein anderes Kind tun, das vielleicht in meinem Alter ist, ähnliche Interessen hat, das es aber deutlich schwerer hat als ich! Die vielfältigen Möglichkeiten, die eigene globale Verantwortung wahrzunehmen, werden so schon für Kinder erlebbar.
Weit verbreitet ist in unseren Gemeinden die Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. Um den 6. Januar herum bringen große und kleine Könige den Segen Gottes in zahllose Häuser und werden zugleich zum Segen für benachteiligte Kinder in aller Welt. Das Kindermissionswerk stellt jedes Jahr schon einige Monate im Voraus auf seiner Homepage www.sternsinger.de umfangreiches Material zum jeweiligen Beispielland bereit. Besonders beliebt sind dabei stets die Aktionsfilme mit Willi Weitzel.
Auch die Kinderfastenaktion von Misereor bietet jedes Jahr in der österlichen Bußzeit vielfältige Anknüpfungspunkte und Materialien, z. B. Vorschläge für Kindergottesdienste. Mit Rucky Reiselustig geht es spielerisch um die Welt. Jedes Jahr werden andere Länder und ihre spezifischen Probleme thematisiert: www.kinderfastenaktion.de.
3. Durch Umweltbildung sensibilisieren und ermutigen
Viele junge Menschen befürchten, dass ihnen bald keine lebenswerte Zukunft mehr bevorsteht. Sie sind besorgt wegen der rasanten Zunahme der Erderwärmung, des Verlustes der Artenvielfalt, der Verknappung des Trinkwassers und vieler Rohstoffe, der Vermüllung der Meere und weiterer Umweltprobleme. Ihre Sorge bringen sie eindrucksvoll in der Bewegung „#FridaysForFuture“ zum Ausdruck.
Die Sorgen der jungen Menschen wegen der Bedrohung der Schöpfung sollten wir in der Kirche erstnehmen und in der Katechese berücksichtigen. Die Behandlung drängender Umweltprobleme und deren Einbettung in die Schöpfungstheologie im Religionsunterricht, bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion oder auf die Firmung bietet die Chance, dass junge Menschen wieder verstärkt Zugang zur Kirche finden. Mit einer Kirche, die durch ihr nachhaltiges, umweltbewusstes Handeln glaubwürdig zur Bewahrung der Schöpfung beiträgt, können sich junge Menschen identifizieren.
Die Deutsche Bischofskonferenz regt in ihrer Arbeitshilfe an, das Thema Schöpfungsverantwortung in die Curricula des Religionsunterrichts und des Theologiestudiums aufzunehmen. Ebenso ist mit Angeboten für eine nachhaltige Entwicklung in den kirchlichen Kindertagesstätten, in der Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenbildung, in den kirchlichen Bildungswerken und -häusern zu ökologisch-sozialer Bewusstseinsbildung und „Globalem Lernen“ beizutragen. Dadurch können alle zu einem nachhaltigen Lebensstil ermutigt werden.
Schöpfungsverantwortung im Kindergarten spielerisch erlernen
Die Sensibilisierung für Gottes gute Schöpfung beginnt bereits im Elternhaus und im Kindergarten. Kinder sind für die Farbenpracht der Blumen, den gaukelnden Flug der Schmetterlinge, die fleißige Bestäubungsarbeit der Bienen oder die Vögel am Futterhaus zu begeistern. In der Natur zeigen sie Entdeckerfreude, können noch staunen, haben aber auch schon ein Gespür für Verwundungen der Natur oder für in Not gekommene Wildtiere. Im Kindesalter kann schon das Fundament für eine gute Artenkenntnis gelegt werden. Nur die Pflanzen und Tiere, die man wirklich kennt, ist man auch bereit zu schützen!
Beim Gärtnern, Basteln mit Naturmaterialien oder Bauen von Nistkästen und Insektenhotels sind Kinder mit Eifer dabei und können ihren Eltern voll Stolz zeigen, was sie gemacht haben. Sie werden spielerisch herangeführt, später einmal Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung zu übernehmen.
Im Kontakt zu örtlichen Naturschutzvereinen, Umweltbehörden oder Förstern kann man evtl. Fachkundige für Naturführungen gewinnen oder die Kinder an Baumpflanzaktionen teilhaben lassen.
Erzählungen im Alten Testament (Schöpfungserzählungen, Arche Noah) und Gleichnisse Jesu (Vögel, Lilien, Senfkorn, Feigenbaum) bieten auch für Kinder Anknüpfungspunkte, sich mit dem Thema der Schöpfung zu befassen. Auch das Wirken von Heiligen wie Franz von Assisi und Hildegard von Bingen bietet didaktische Ansatzpunkte hierfür.
Mit Schöpfungsthemen in Kindergottesdiensten oder in der Religiösen Kinderwoche kann dieses Arbeitsfeld der kirchlichen Kindergärten unterstützt und weitergeführt werden.
Die Angebote der Erwachsenenbildung nutzen
Das Katholische Forum im Land Thüringen, das Bildungswerk im Bistum Erfurt und das Katholische Büro Erfurt führen u. a. Veranstaltungen zum nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit der Schöpfung durch. Oft werden diese ökumenisch vorbereitet. Auch das Bildungshaus „St. Ursula“ in Erfurt und das Marcel-Callo-Haus in Heilbad Heiligenstadt bieten Veranstaltungen zu diesem Themenkreis an.
Informationen zu Bildungsangeboten sind unter dem Portal des Bistums www.bistum-erfurt.de zu finden oder können bei den genannten Stellen erfragt werden.
Viele Verbände wie der Caritasverband für das Bistum Erfurt und das Kolpingwerk Erfurt befassen sich mit der Verantwortung der Christen für den Erhalt der Schöpfung. Dazu führen sie mit ihren Mitarbeitenden auch Fortbildungen durch.
Seit 2013 gibt es von der Caritas und dem Bundesverband Energie- und Klimaschutz die Initiative „Stromspar-Check“ (SSC). Caritas-Mitarbeitende beraten Haushalte mit geringem Einkommen, wie der Energie- und Wasserverbrauch gesenkt und zugleich Geld gespart werden kann. So konnten allein in Erfurt seit Projektbeginn im Jahr 2013 bald 4.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Bundesweit gibt es über 150 lokale lokale Angebote für den Stromspar-Check: www.stromspar-check.de.
4. Eigene Traditionen wiederentdecken
Die katholische Kirche verfügt über einen reichen Schatz an Traditionen, mit denen Gebräuche und Einsichten unserer Vorfahren über das Leben mit Gott und in der Welt von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Der heilige Thomas Morus soll einmal gesagt haben: „Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern die Weitergabe der Flamme.“
Bei der Pflege von Traditionen geht es also nicht darum, etwas zu machen, weil es „immer schon so gemacht“ wurde. Dann würde eine Tradition irgendwann abbrechen, weil sie uns Menschen nichts mehr geben kann und sinnentleert einfach nur noch verrichtet wird. Vielmehr sollte man nach dem Kern unseres Brauchtums suchen und fragen, was uns die Erfahrung der vergangenen Jahrhunderte auch heute sagen kann. Oft ist man dann überrascht, wie aktuell vieles ist, was man längst als Relikte aus Großmutters Zeiten abgelegt hatte.
Wenn es um unsere Einbettung in Gottes Schöpfung geht, können wir viele alte kirchliche Traditionen wiederentdecken und in unseren heutigen Kontexten neu fruchtbar machen. So ist zum Beispiel der bewusste Verzicht in der Fastenzeit hoch aktuell und auch für Menschen außerhalb der Kirche anschlussfähig. Wir merken: Auf vieles von dem, was wir meinen zu brauchen, können wir eigentlich gut verzichten. Dies kann eine heilsame Erfahrung sein und dabei helfen, ein anderes Verständnis von Lebensqualität zu entwickeln – weniger ist eben oft mehr.
Fleischverzicht am Freitag – neu bewusst gemacht
Im Bistum Erfurt sind wir mit fleischlichen Genüssen reich gesegnet. Bratwurst und Rostbrätel, Gehacktes, Stracke und Feldgieker – da bleiben keine kulinarischen Wünsche offen. Gute Fleisch- und Wurstwaren gehören bei uns einfach dazu. Ob Grillen bei RKW und Pfarrfest oder das Picknick bei einer Wallfahrt – eine gute Wurst darf nicht fehlen.
Doch auch bei Fleisch kommt es auf das richtige Maß an. Aus Genuss kann schnell Verdruss werden. Eine zu fleischlastige Ernährung wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus, begünstigt Übergewicht und steigert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Unser hoher Fleischkonsum hat aber auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Zur Fleischproduktion sind enorme Flächen notwendig, vor allem zur Futtermittelproduktion. Weltweit sind schon 40% der Agrarflächen nur damit belegt. Zur Deckung des europäischen Fleischbedarfs wird in Südamerika wertvoller Regenwald gerodet, um Futtermittel wie Soja anbauen zu können, die wir für unsere Schlachttiere brauchen. Dazu kommt ein exorbitanter Wasserbedarf: Die Produktion von nur einem Kilogramm Rindfleisch verbraucht über 15.000 Liter Trinkwasser. Ganz zu schweigen von der noch immer mangelhaften Rücksicht auf das Tierwohl in unserer modernen Massentierhaltung.
Wir Katholiken kennen den Fleischverzicht am Freitag, um uns an das Leiden und Sterben Jesu zu erinnern. Die negativen Auswirkungen eines übermäßigen Fleischkonsums auf die Schöpfung könnte diese bei vielen Menschen in Vergessenheit geratene Tradition wieder neu mit Sinn füllen. Ein Verzicht auf Fleisch am Freitag kann unser Bewusstsein stärken, dass die Art unserer Ernährung für unsere Umwelt nicht ohne Folgen ist und dass wir dafür Verantwortung übernehmen sollten. Zum anderen kann uns der Verzicht auch zu einem neuen Genuss von gutem Fleisch und guter Wurst führen – was man nicht ständig hat, weiß man umso mehr zu schätzen.
Bitttage und Flurprozessionen schöpferisch begehen
In vielen Gemeinden unseres Bistums werden an den Tagen vor Christi Himmelfahrt Bittprozessionen abgehalten. Mancherorts ist die Tradition bereits seit mehreren Jahrhunderten nachweisbar. Der Ablauf ist regional recht unterschiedlich. Meistens ziehen die Gläubigen über Feldwege in einen benachbarten Ort, wo dann die Heilige Messe gefeiert wird. Anderswo werden die um einen Ort herum aufgestellten Flurkreuze abgelaufen oder man besucht ein Klüschen auf freiem Feld. Ursprünglich dienten diese Bittprozessionen dazu, vor Beginn des Sommers Gott um gedeihliches Wetter und eine gute Ernte zu bitten. Auch wurde gebetet, dass Gott „Blitz, Hagel und jedes Unheil“ fern halten möge. Bitttage haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Angesichts immer häufiger auftretender Wetterkapriolen – Hitzeperioden und Trockenheit einerseits, Starkregen und Gewitterstürme andererseits – haben wir auch heute jeden Grund, Gott um seinen Segen für Natur und Landwirtschaft zu bitten.
Vielleicht bietet es sich ja an, bei einer Bittprozession mit neuen Gestaltungselementen aktuelle Anliegen des Umweltschutzes ins Gebet zu nehmen. So könnte man unterwegs Stationen einlegen und an einem Weizenfeld einen Impuls zu den Auswirkungen des hohen Fleischkonsums auf die Getreidepreise weltweit geben oder an einem Bachlauf das Artensterben bei Insekten, Fischen und Vögeln thematisieren. An einer Autobahnbrücke ließe sich unser Mobilitätsverhalten hinterfragen.
Eine Bittprozession gibt immer auch Gelegenheit, die Schönheit der Schöpfung zu erfahren. Vielleicht kann man einen Kilometer schweigend zurücklegen und ganz bewusst auf die Vogelstimmen und die anderen Geräusche der Natur lauschen.
5. Schöpfungsverantwortung zum Schwerpunkt machen
Kaum jemand wird widersprechen, dass es wichtig ist, Gottes Schöpfung zu bewahren und mit den Ressourcen dieser Welt pfleglich umzugehen. Wenn es dann aber darum geht, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, fallen uns viele Gründe ein, warum wir auf Fragen von Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerade bei diesem Bauprojekt, diesem Fest oder diesem Einkauf keine Rücksicht nehmen können. Natürlich kostet Umweltschutz Geld, verursacht Umstände und verlangt nach Veränderung gewohnter Abläufe. Auch sind Ergebnisse und Erfolge nicht immer gleich zu erkennen. Häufig scheinen andere Anforderungen und Probleme viel drängender zu sein. Doch der Raubbau, den wir an unserer Erde und an unseren Lebensgrundlagen betreiben, darf uns nicht egal sein und darf auch nicht unter ferner liefen abgehandelt werden. Ein einfaches „Weiter so“ darf es im Blick auf unsere Verantwortung für unsere Umwelt nicht geben. Das schulden wir unserem Schöpfer genauso wie den Generationen unserer Kinder und Enkel, die ihr Leben in unserer geschundenen Welt noch vor sich haben. Daher müssen wir umdenken, auch als Katholische Kirche in Thüringen.
Wir müssen die Verantwortung für unsere Schöpfung künftig noch mehr als Schwerpunkt auch im praktischen Handeln der Bistumsleitung etablieren. Das Bischöfliche Ordinariat mit seinen vielfältigen Einrichtungen, Veranstaltungen und Projekten sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen, damit auch die Gläubigen vor Ort und alle in der Gesellschaft zu mehr Schöpfungsverantwortung ermutigt werden. Dabei muss es nicht immer gleich der große Wurf aus einem Guss sein – schon kleine Zeichen sind ein guter Anfang.
Wallfahrten nachhaltig gestalten
In unserem Bistum gibt es ein reges Wallfahrtsleben. Gerade wenn wir in den Gemeinden vor Ort weniger werden, ist es gut, sich zu verbindenden Orten aufzumachen und zu spüren, dass wir als Katholiken in Thüringen nicht allein unterwegs sind. Natürlich verbrauchen Wallfahrten und andere kirchliche Veranstaltungen Ressourcen und verursachen klimaschädliche Treibhausgasemissionen. Hier gilt es, von der Vorbereitung bis zur Veranstaltung den Dreischritt „Vermeiden – verringern – kompensieren“ zu verwirklichen.
Das Vermeiden von Ressourcenverbrauch beginnt schon damit, dass man konsequent Printprodukte wie Plakate und Liedhefte auf Recyclingpapier drucken lässt oder statt einer Vorbereitungssitzung, zu der mehrere Teilnehmende anreisen müssen, lieber eine Videokonferenz plant.
Verringern kann man viele umweltschädliche Dinge: auf Plastikgeschirr verzichten, Abfälle richtig trennen, ökologisch faire und regionale Erzeugnisse verwenden oder die Anreise mit Bus und Bahn bewältigen.
Unvermeidbare Emissionen, wie beim Stromverbrauch für die Beschallung und Beleuchtung oder bei der Anreise zur Wallfahrt, können mithilfe der Klima-Kollekte berechnet und ausgeglichen werden. Übrigens: Bereits seit 2008 findet der Katholikentag klimaneutral statt. Damit hat er für nachhaltige Großveranstaltungen Maßstäbe gesetzt. Auch deshalb freuen wir uns auf den 103. Deutschen Katholikentag 2024 in Erfurt.
Bildungshäuser ökologisch zertifizieren – Der „Grüne Hahn“
In vielen Bistümern und evangelischen Landeskirchen ist es bereits seit einigen Jahren üblich, Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen nach Umweltstandards zertifizieren zu lassen. Als Zertifikat für ein erfolgreiches kirchliches Umweltmanagement wird der „Grüne Hahn“ vergeben. Das markante Schild findet sich zum Beispiel am Roncalli-Haus in Magdeburg, am Kloster Huysburg und am Zinzendorfhaus in Neudietendorf.
Dieses Umweltzertifikat, das eng an die EMAS-Verordnung der Europäischen Union angelehnt ist, weist darauf hin, dass das Umweltverhalten und die Auswirkungen des gemeindlichen Lebens auf die natürlichen Ressourcen und auf die Mitgeschöpfe kontinuierlich überprüft und nach Möglichkeit verbessert wird. Ein Umweltteam erstellt und verfolgt ein auf die jeweilige Situation abgestimmtes Umweltprogramm. Fortbildungskurse bietet z. B. die Fachstelle Kirchliches Umweltmanagement der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland an, die an der Evangelischen Akademie Wittenberg angesiedelt ist (www.ev-akademie-wittenberg.de).
Bistümer wie Osnabrück und Limburg beteiligen sich an der Aktion „Faire Gemeinde“ und bringen dadurch, auch in weltkirchlicher Partnerschaft, ihre Verbundenheit mit den Ländern ärmerer Regionen zum Ausdruck.
An dem im Jahr 2021 gegründeten Projekt „öko + fair vor Ort“ des Bistums Erfurt (siehe Kapitel 10) haben sich inzwischen auch das Bildungshaus „Marcel Callo“ in Heilbad Heiligenstadt und das Bildungswerk im Bistum Erfurt beteiligt.
6. Gebäudemanagement umweltverträglich gestalten
In den nächsten Jahren stehen in etlichen Kirchen und Gebäuden kirchlicher Einrichtungen oft Sanierungsmaßnahmen an. Hierbei bietet sich die Chance, Baumaterialien und Geräte einzusetzen, die sparsamer im Energieverbrauch und noch umweltverträglicher und schadstoffärmer sind. Produkten mit dem Label „Blauer Engel“ oder „Stop Climate Change“ ist dabei der Vorzug zu geben. Mit einer guten Dämmung und mit einer modernen Wärmeschutzverglasung können z. B. bei Gebäuden bis zu 50 % Energie eingespart werden. Die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) sind zu beachten.
Steht eine Heizungsumstellung an, dann sollte spätestens jetzt der Einsatz Erneuerbarer Energien geprüft werden. Je nach Größe der Kommune wird dies ab 2026 oder 2028 auch zur Pflicht. In Neubaugebieten müssen bereits ab 2024 verpflichtend mindestens 65 % Erneuerbare Energien zur Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Am besten gelingt das mit einer Wärmepumpe, dem Einsatz von Biomasse oder Solarthermie. Eine gute Beratung durch eine Fachfirma ist beim Austausch der Heizsysteme genau so wichtig, wie bei der Betreibung bestehender Heizungsanlagen. Denn wer richtig heizt und lüftet, kann deutlich Kosten und Energie sparen.
Generell ist beim Gebäudemanagement zu überprüfen, inwieweit für die Instandhaltung, den laufenden Betrieb und die Reinigung umweltverträgliche Materialien verwendet werden. Hierfür bietet z.B. die „Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland mbH WGKD“ (www.wgkd.de) Empfehlungen an. Die Umweltbeauftragten der katholischen Bistümer und der evangelischen Landeskirchen haben mit Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) einen Katalog nachhaltiger Produkte ausgewählt und zusammengestellt. Die WGKD vereinbart mit Herstellern und Dienstleistern auch Rahmenverträge, die alle kirchlichen und caritativen Einrichtungen direkt nutzen können. Gute Tipps gibt es auch bei der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de)
Bei anstehenden Baumaßnahmen wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem Umweltbeauftragten unseres Bistums in Verbindung zu setzen und sich von ihm beraten zu lassen. Auch zum laufenden Gebäudemanagement kann der Umweltbeauftragte wertvolle Hinweise geben. Weitere Informationen: www.bistum-erfurt.de, Beauftragter für Umweltfragen
Sanierungsmaßnahmen mit Weitblick planen
Kirchliche Gebäude „sind im Rahmen anstehender Sanierungen ambitioniert energetisch zu ertüchtigen. Dabei muss der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern Standard werden. Zudem können Gebäude zu Standorten für eine eigene Energieproduktion werden, zum Beispiel zur Stromerzeugung über Kraft-Wärme-Kopplung oder Photovoltaik.“ (Arbeitshilfe Nr. 301 der DBK).
Bei energetischen Sanierungsmaßnahmen wird empfohlen zu prüfen, ob Fördermöglichkeiten des Bundes (www.foerderdatenbank.de des Bundeswirtschaftsministeriums) oder des Freistaates Thüringen genutzt werden können.
Beispiel: Photovoltaik
Als Pilotprojekt mit Beispielcharakter kann in unserem Bistum die Dacheindeckung der katholischen Kirche in Burgwalde im Eichsfeld mit Solarziegeln gesehen werden. Sie wurde vom Freistaat Thüringen und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Die Photovoltaikanlage wurde am 06.12.2000 in Betrieb genommen.
Photovoltaikanlagen können heute oft leicht installiert werden. Auch kleine Anlagen mit 5 – 10 kWpeak auf einem Pfarrhaus oder Nebengebäude können schon einen wichtigen Beitrag zur Energiebilanz der Liegenschaft leisten. Größere Anlagen, wie in Burgwalde, können noch mehr (50 – 70T kWh) und sind ein weithin sichtbares Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung.
Mittlerweile wurden dazu auch die notwendigen Anpassungen in den denkmalschutz- und baurechtlichen Rahmenbedingungen in Angriff genommen.
Wenn der Pfarrgemeinde ein günstiges Grundstück zur Verfügung steht, kann auch die Errichtung einer Freiflächenanlage geprüft werden. Diese Anlagen können dann je nach Größe, den gesamten Jahresbedarf an Elektroenergie für viele Haushalte klimaneutral gewinnen. Eine Beratung durch die Thüringer Energie- und Green- Tech-Agentur (www.ThEGA.de) oder einen Fachbetrieb lohnt sich in jedem Fall.
Ist eine eigene Stromerzeugung in dieser Art nicht möglich, kann ein Wechsel des Stromlieferanten hin zu einem Ökostromanbieter geprüft werden. Ökostrom wird nahezu CO2-frei produziert. Mit dem Kauf von Ökostrom werden der Ausbau von regenerativen Kraftwerken und eine dezentrale Energieerzeugung gefördert.
Neben der Wahl eines geeigneten Stromanbieters sollten Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz im Vordergrund stehen. So können z. B. bei der Anschaffung eines Kühlschranks der Energieeffizienzklasse A+++ der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen erheblich gesenkt werden.
Potenzial zur Energieeinsparung bietet eventuell auch eine Kooperation mit kommunalen Partnern wie den Stadtwerken.
Beispiel: Leuchtmittel austauschen
Bei der Beleuchtung in kirchlichen Häusern lohnt sich der Umstieg auf eine LED-Beleuchtung, die aus wenig Strom viel Helligkeit holt. So bewältigt beispielsweise eine 8-Watt-LED-Lampe dasselbe, was eine 60-Watt-Birne früher geleistet hat. Dagegen sind Kompaktleuchtstofflampen (üblicherweise bekannt als Energiesparlampen) nicht mehr zu empfehlen, da sie umweltschädliche Materialien enthalten und außerdem eine kürzere Lebensdauer haben (www.kleine-kniffe.de).
Der Einsatz von LED-Leuchten führt zu einer höheren Energie-Effizienz, Kostensenkung und Langlebigkeit der Leuchtmittel. Außerdem hilft eine Umstellung auf diese Art von Leuchtmitteln, die CO2-Emissionen zu senken.
Die „WGKD – Die Einkaufsplattform der Kirchen“ bietet Beratungen zum Kauf geeigneter Leuchtmittel, Beleuchtungskonzepte, Bezugsquellen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen an. Auch das Bischöfliche Bauamt steht zu entsprechender Beratung zur Verfügung.
7. Nachhaltig wirtschaften, ökologisch. fair. sozial einkaufen
Mit der Art unseres Kauf- und Konsumverhaltens üben wir als Kirchen erheblichen Einfluss aus. Es ist zu wünschen, dass sich dieses Kauf- und Konsumverhalten immer stärker an einer umweltverträglicheren, nachhaltigeren und sozial gerechteren Wirtschaft orientiert.
Deshalb regt der Katholikenrat an:
- Die Bistumsleitung, die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden und die Leitungen kirchlicher Einrichtungen werden aufgerufen, stärker als bisher mit den natürlichen Ressourcen zu haushalten, nachhaltig zu wirtschaften und Einsparpotenziale zu erkennen. Schwerpunkte sollten hierbei die Verringerung des Verbrauchs von Energie, Trinkwasser, Papier, Plastik und von wertvollen Rohstoffen sein.
- Unnötige Autofahrten sollten, wo möglich, vermieden werden. Stattdessen sollten kurze Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt oder der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) genutzt werden. Wo es möglich ist, sollen Fahrgemeinschaften gebildet und damit unsere Mobilität umweltfreundlicher gestaltet werden.
- Wertvolle Rohstoffe, deren Vorkommen weltweit begrenzt sind, wie z. B. das Coltan in den Handys und Smartphones, sind einer sinnvollen Wiederverwertung zuzuführen, wie das bereits seit Jahren in unserem Bistum durch „missio“ und „Kolping“ unterstützt wird. Sammelboxen hierfür können unter www.missio-hilft.de/kolping-handys bestellt werden. In vielen Pfarrbüros und zur Bistumswallfahrt ist es bereits gute Praxis, solche Sammelboxen aufzustellen.
Im Verbraucherverhalten auf Nachhaltigkeit achten
Gute und vielfältige Anregungen für ein nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten bieten die Broschüren „Kleine Kniffe – Das Magazin für einen nachhaltigen Einkauf“ (www.kleine-kniffe.de), die die Kirchen und die kirchlichen Wohlfahrtsverbände seit 2017 gemeinsam herausgeben. Die ersten beiden Ausgaben hat der Katholikenrat bereits an alle Pfarrgemeinden verteilt.
Die Broschüren „Kleine Kniffe“ geben den kirchlichen Institutionen und Pfarreien zahlreiche Tipps, wie sie nachhaltig und umweltbewusst einkaufen, haushalten und wirtschaften können. Im Editorial der ersten Ausgabe dieser Broschüre heißt es: „Die Beschaffung in kirchlichen Institutionen besitzt große Potenziale, durch nachhaltig orientiertes Einkaufsverhalten den Klimaschutz zu fördern.“ Die Anregungen dieses Magazins reichen von Empfehlungen zu mehr Energieeffizienz, Energieeinsparungen und dem Einsatz erneuerbarer Energien über den Kauf von umweltschonendem Büromaterial, Recycling-Druckerpapier und fair gehandelten Produkten bis hin zur Ausrüstung der Gebäude mit verbrauchsarmer Beleuchtung. Eine Wiederverwertung (Recycling) von Geräten und Rohstoffen oder eine Verlängerung ihrer Langlebigkeit durch Reparatur z. B. in einem Repair-Café ist angesichts der Endlichkeit vieler Rohstoffvorkommen weltweit zunehmend von Bedeutung.
Ökumenisch handeln, mit Umweltvereinen zusammenarbeiten
Die großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit angesichts der Umweltprobleme steht, fordern gemeinschaftliches Handeln, über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg. Gerade die Christen der evangelischen Landeskirchen können vielfältige Erfahrungen aus ihrem Engagement im Umwelt- und Klimaschutz einbringen. Ihr Engagement gründet sich auf die Arbeit der kirchlichen Umwelt- und Friedensgruppen in der ehemaligen DDR und auf den ökumenisch gestalteten „Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, der letztlich zur politischen Wende im Jahr 1989 beigetragen hat.
In ihrem Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung können die Kirchen voneinander lernen, sich gegenseitig bestärken und Aktionen gemeinsam begehen. So wurde beispielsweise die Petition zur Einführung eines Tempolimits auf unseren Autobahnen von vielen Gruppen und Einzelpersonen im Bistum Erfurt unterstützt.
Ebenso wird angeregt, sich an Aktionen der ortsansässigen Umwelt- und Verbraucherverbände zu beteiligen, wie es Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika vorgeschlagen hat. Durch gemeinschaftliches Handeln entstehen Synergieeffekte, kann das Engagement für Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Ökologie mehr Durchsetzungskraft gewinnen.
Spirituelle Anregungen hierfür bieten neben der Enzyklika „Laudato si´“ auch das Material „erd-verbunden: ökumenisch-geistlicher Übungsweg zur Schöpfungsverantwortung im Anthropozän“, die Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“ oder andere Fastenimpulse wie „Mobil ohne Auto“.
Das Bistum Erfurt ist zudem Mitträger der Aktion „Autofasten Thüringen“. Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, dem Verkehrsverbund Mittelthüringen, dem Verband „bus & bahn thüringen“ sowie über 60 weiteren Partnern lädt das Bistum die Menschen in Thüringen von Aschermittwoch bis Karsamstag ein, mal einen anderen Weg einzuschlagen und das Autofasten auszuprobieren und über das eigene Mobilitätsverhalten nachzudenken. Mit vielfältigen Aktionen soll dazu ermuntert werden, hin und wieder aufs Auto zu verzichten und stattdessen den ÖPNV, das Fahrrad oder die eigenen Füße zu nutzen, um mobil zu sein. Aber allen Beteiligten ist klar, dass in einem Flächenbundesland wie Thüringen, das über weite Strecken sehr ländlich geprägt ist, nicht sehr viele Menschen auf das Auto gänzlich verzichten können. Deshalb ist es den Initiatoren wichtig, auch auf die Kompensationsmöglichkeit unvermeidlicher Emissionen hinzuweisen. Dazu wurde im Jahr 2024 im Schwarzatal mit der Anlage eines Autofasten-Waldes begonnen, der mit Spendengeldern finanziert wird und in den nächsten Jahrzehnten viele Tonnen CO2 binden wird.
8. Kirchenland, Kirchengebäude und kirchliche Geldanlagen
Aus Gründen des Boden- und Wasserschutzes sowie zum Erhalt der Artenvielfalt sollte Kirchenland einen nachhaltigen Umgang erfahren. Das betrifft die Anlage und Pflege der Flächen um kirchliche Gebäude und der Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft sowie die Art der eigenen Bewirtschaftung weiterer Flächen des Bistums. Bei Verpachtung land- und forstwirtschaftlicher Flächen kirchlicher Eigentümer empfiehlt auch die Deutsche Bischofskonferenz, dass die Auswahlkriterien für potenzielle Pächterinnen und Pächter sowie die Gestaltung der Pachtverträge und Pachtzinse eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft fördern.
Deshalb regt der Katholikenrat im Bistum Erfurt an:
- Zum Schutz des Bodens, des Wassers und der Artenvielfalt sollte das Kirchenland nachhaltig und ökologisch bewirtschaftet werden; neue Pachtverträge sind dementsprechend zu gestalten.
- Generell ist zu prüfen, inwieweit sich kirchliche Gebäude für klimaschützende Maßnahmen (z. B. Photovoltaik-Anlagen) und für Artenschutz-Maßnahmen (z. B. für Gebäudebrüter und Fledermäuse) eignen. Der Klimawandel, der steigende Verbrauch erschöpfbarer Ressourcen, die Umweltverschmutzung und der Rückgang der Artenvielfalt führen uns mit aller Deutlichkeit die Notwendigkeit zu handeln vor Augen.
- Bei kirchlichen Baumaßnahmen, die unvermeidbar zu Umweltbeeinträchtigungen führen, sind geeignete Kompensationsmaßnahmen zugunsten der Umwelt zu ergreifen, wie es auch das Baugesetzbuch und das Bundesnaturschutzgesetz vorsehen.
- Kirchliche Finanzen sollten ethisch unbedenklich, nachhaltig und sozial angelegt werden.
Kirchenland nachhaltig bewirtschaften
Der Boden ist ein wertvolles Schutzgut, das nicht vermehrbar ist. Es stellt die Existenzgrundlage für Mensch, Tiere und Pflanzen dar. Deshalb sollten kircheneigene Flächen so wenig wie möglich versiegelt oder überbaut werden; der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist zu vermeiden. Wenn Kirchenland zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung verpachtet wird, sollten Pachtverträge und Pachtzins so gestaltet werden, dass die Bewirtschaftung nachhaltig und ökologisch erfolgt. Die Deutsche Bischofskonferenz empfiehlt bei der Auswahl potenzieller Pächter ein transparentes Vergabeverfahren.
Im Bistum Erfurt wurde als Hilfestellung für die Kirchengemeinden im Jahr 2024 ein neuer landwirtschaftlicher Musterpachtvertrag erarbeitet, der ausführliche Vorgaben für eine ökologische Bewirtschaftung kircheneigener landwirtschaftlicher Grundstücke beinhaltet. Den gewerblichen Pächtern wird die Entscheidung überlassen, welche ökologischen Kriterien für sie erfüllbar sind. Die Kirchengemeinden und ihre Kirchenvorstände werden vom Bischöflichen Ordinariat sowie vom Katholikenrat aufgefordert, beim Abschluss neuer Pachtverträge stärker als bisher auf das Einhalten ökologischer Standards zu achten. Der neue Musterpachtvertrag wurde von der Abteilung Recht und Liegenschaften des Bischöflichen Ordinariats Erfurt in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Laudato si´“ des Katholikenrates erarbeitet. Die Arbeitsgruppe konnte hierfür auf Musterpachtverträge zurückgreifen, die der Naturschutzbund Deutschlands (NABU) im Rahmen der Aktion „Fairpachten land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke“ entwickelt hatte. Der neue landwirtschaftliche Musterpachtvertrag wurde im Amtsblatt des Bistums Erfurt Nr. 2/2024 veröffentlicht.
Pfarr- und Klostergärten, Freiflächen um kirchliche Gebäude, aber auch Friedhöfe bieten viel Potenzial, um der Bedrohung der Artenvielfalt durch Verlust der Lebensräume entgegen zu wirken. Artenreiche Wiesen und Ruderalflächen, nektarreiche Stauden und Sträucher, Obstbäume, Fassaden- und Dachbegrünung sowie Nisthilfen können auch in den Städten und Dörfern zahlreichen Wildpflanzen und Wildtieren einen wichtigen Lebensraum bieten. Hier haben es die Kirchengemeinden selbst in der Hand, zur Bewahrung von Gottes wunderbarer Schöpfung beizutragen, zum Beispiel durch
- die Anpflanzung geeigneter Blühpflanzen, Obstbäume und Früchte tragender Sträucher für Insekten und Vögel;
- Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden und Insektiziden;
- Erhalt von Nistgelegenheiten (in Hecken und Bäumen) und das Anbringen von Nisthilfen und Insektenhotels;
- Durchführung von Gehölzschnittmaßnahmen außerhalb der Brutzeit;
- extensive Mahd der Wiesenflächen u. v. m.
Anregungen für eine nachhaltige und ökologische Nutzung des Bodens haben z. B. Naturschutzvereine wie NABU, BUND und Grüne Liga parat. Vielleicht bietet sich Kirchenland auch zum Aufstellen von Bienenbeuten an. Nisthilfen können gut mit Kindern oder Jugendlichen angefertigt und angebracht werden.
Artenschutzmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden umsetzen
In den letzten Jahrzehnten haben viele Fledermäuse und Vögel, die an oder in Gebäuden gewohnt haben, ihre Quartiere verloren, weil die Gebäude umfangreich saniert oder renoviert wurden. Mit dem Verschließen oder Verkleiden von Mauerfugen und Dach- bzw. Turmöffnungen sind Fledermäuse, Schleiereulen, Turmfalken und Dohlen in Wohnungsnot gekommen. Den Sanierungsmaßnahmen sind oft Nistplätze für Mauersegler, Mehlschwalben und Haussperlinge zum Opfer gefallen.
Der Naturschutzbund Deutschlands (NABU) hat eine Aktion gestartet, um Kirchen auszuzeichnen, die Nistgelegenheiten für Vögel oder Quartiere für Fledermäuse erhalten oder neu schaffen. An diesen Kirchen wird eine Plakette mit der Aufschrift „Lebensraum Kirchturm – Diese Gemeinde wird für ihr Engagement ausgezeichnet“ angebracht. Der Katholikenrat regt an zu prüfen, ob die eigene Kirche oder kirchlichen Gebäude geeignet sind, derartige Hilfsmaßnahmen für bedrohte Tierarten zu ergreifen und diese dann auch umzusetzen.
Weitere Tipps zum Artenschutz sind abrufbar unter www.umwelt.elk-wue.de.
Gott hat uns die Verantwortung übertragen, für unsere Mitgeschöpfe zu sorgen und ihren Fortbestand zu sichern. Dieser Auftrag gilt auch für die Kirchen.
9. Mobilität umweltverträglich gestalten
Gerade in einem Flächenbistum wie unserem ist jedem schnell klar, wie unverzichtbar es ist, mobil zu sein. Das weiß nicht nur jeder Pfarrer, der nach seinen Sonntagsgottesdiensten in verschiedenen Orten häufig mehr als 100 Kilometer im Auto zurückgelegt hat. Das wissen spätestens nach den Zusammenlegungen der Pfarreien auch die meisten Gemeindemitglieder, die zu Gottesdiensten, Veranstaltungen und Sitzungen in andere Orte fahren müssen. Verkehr ist jedoch auch einer der größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland. Daher sind wir alle gefordert zu überlegen, welche Fahrten mit dem Auto wirklich notwendig sind, wie man bei unvermeidbaren Fahrten die Folgen für die Umwelt minimieren kann und wo mit kleinen Kniffen die Nutzung von Bus und Bahn doch einfacher sein kann als gedacht. Die Palette der Möglichkeiten ist groß. Auch hier gilt: Kleine Schritte sind ein guter Anfang.
Emissionen ausgleichen – die Klima-Kollekte
Gemeinsame Bustouren haben in vielen Gemeinden einen festen Platz im Veranstaltungskalender. Ob die traditionelle Krippenfahrt durch das Eichsfeld, der Besuch einer Partnergemeinde an der Mosel oder der jährliche Seniorenausflug in den Thüringer Wald: Anlässe, als Gemeinde gemeinsam zu verreisen, gibt es viele. Auch das Bischöfliche Ordinariat ist einmal jährlich mit dem Bus zum Betriebsausflug auf Tour.
Dabei ist die Fahrt im Reisebus nicht nur besonders gesellig, sondern auch vergleichsweise umweltschonend. Auf den einzelnen Fahrgast gerechnet stößt ein Reisebus mit etwa 30 g pro km sogar etwas weniger CO2 aus als die Bahn. Zum Vergleich: Für herkömmliche Autos liegt dieser Wert bei durchschnittlich 140 g CO2 pro km. Dennoch entstehen auch bei einer Gemeindefahrt mit dem Reisebus nicht unerhebliche Emissionen. Es ist möglich, diese zu berechnen und durch eine Spende zu kompensieren. Mit dem gesammelten Geld werden beispielsweise neue Bäume gepflanzt, in Indien der Austausch von Petroleum- gegen Solarlampen gefördert oder in Kamerun die Haushalte eines Dorfes mit energieeffizienten Herden ausgestattet.
Hierfür wurde der Kirchliche Kompensationsfond „Klima-Kollekte“ ins Leben gerufen. Auf der Homepage www.klima-kollekte.de kann man für Reisen oder alle Arten kirchlicher Veranstaltungen den ökologischen Fußabdruck relativ genau berechnen und die entstandenen Emissionen mit einer Spende ausgleichen.
Übrigens: Für eine Seniorenfahrt von Breitenworbis zum Hülfensberg und zurück fallen bei einem vollbesetzten Reisebus etwa 140 kg CO2 an. Die Kompensation über die Klima-Kollekte beträgt insgesamt nur 3,22 €!
Fahrgemeinschaften bilden
Vom Eichsfeld bis nach Hildburghausen, von Gerstungen bis nach Weida: Unser Bistum Erfurt geht in die Fläche. Ob Pfarrer, Gemeindereferent, Diakonatshelferin, Kirchenvorstandsmitglied oder Lektorin: Wer haupt- oder ehrenamtlich in der Kirche mitarbeitet, ist meistens viel in Thüringen unterwegs.
Besonders zwischen dem Eichsfeld und Erfurt gibt es einen regen kirchlichen Pendelverkehr – zumeist mit dem Auto. Hier bietet die Bahn eine gute Alternative. Von Heiligenstadt bis Erfurt braucht der Regionalexpress gerade einmal 1:15 h. So schnell schafft man es mit dem Auto sicher nicht. Auch wer auf einem der Dörfer wohnt, kann den Zug einmal ausprobieren und mit dem Auto bis Heiligenstadt, Leinefelde oder Silberhausen fahren. Parkmöglichkeiten gibt es genug und die Bahn ist oft viel zuverlässiger als ihr Ruf. Wenn der Beginn einer Veranstaltung nicht zum Fahrplan passt, kann man es ja einmal umgedreht versuchen: Die Konferenz geht erst los, wenn der Zug aus dem Eichsfeld da ist!
Passt die Anreise mit der Bahn nicht, so kann man Fahrgemeinschaften bilden. Das kann man in der Regel problemlos organisieren und unterwegs auch noch Neuigkeiten austauschen. Vielleicht kann perspektivisch die Bistumshomepage zu bestimmten Veranstaltungen als Mitfahrbörse fungieren. Übrigens: Jede gesparte Autofahrt zwischen dem Eichsfeld und Erfurt vermeidet hin und zurück etwa 25 Kilogramm CO2.
10. Bistumsprojekt „öko + fair vor Ort“
Am 25. Juni 2021 startete das Bistum Erfurt das Projekt „öko + fair vor Ort“ unter dem Motto „Die Sorge für das gemeinsame Haus der Erde – Eine Aufgabe für uns!“. Mit diesem Projekt soll das bereits vorhandene ökologische und faire Handeln von engagierten Einrichtungen, Kirchorten und Verbänden sichtbar gemacht und anerkannt werden. Ziel ist es aber auch, neue Initiativen anzuregen und so einen aktiven Beitrag für weltweite Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung zu leisten. Wer sich an diesem Bistumsprojekt beteiligen will, geht eine Selbstverpflichtung ein, indem jeweils drei selbstgewählte faire und ökologische Kriterien umgesetzt werden:
Zu den ökologischen Kriterien zählen: Verpackungsarmes Einkaufen, Maßnahmen zur Energieeinsparung, Verwendung von Recyclingpapier und eine nachhaltige Mobilität, außerdem vorhandene Außenanlagen so zu gestalten, dass sie auch als Lebensraum für Pflanzen und Tiere dienen können. Darüber hinaus können sich Projektteilnehmende auch andere ökologische Aktivitäten vornehmen. Als faire bzw. soziale Kriterien werden vorgeschlagen: Mindestens zwei „Faire Produkte“ im Alltag und bei Veranstaltungen zu verwenden, ebenso regionale und biologisch erzeugte Produkte. Weiterhin zählt hierzu: jährlich Aktionen und Veranstaltungen zum Fairen Handel durchzuführen, eine dementsprechende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Weltpartnerschaften mit Partnern aus dem Globalen Süden zu pflegen oder darüber hinaus eigene „faire“ Aktivitäten durchzuführen.
Bei der Auswahl der Kriterien sind ausdrücklich eigene Ideen zum Umweltschutz sowie zum fairen und sozialen Zusammenleben erwünscht! Zur Ausarbeitung und Koordinierung des Projekts „öko + fair vor Ort“ wurde eine Projektgruppe gebildet, in der vom Bistum Erfurt die Hauptabteilung Pastoral des Bischöflichen Ordinariats, die Katholische Erwachsenenbildung, der Katholikenrat, der BDKJ Thüringen sowie der Weltladen Dachverband Fair-Handels-Beratung Thüringen mitarbeiten. Bischof Dr. Ulrich Neymeyr übernahm hierzu die Schirmherrschaft.
(Anm. d. Red.: Nähere Informationen zum Projekt finden sie im nachfolgenden Artikel in diesem Heft.)
Die Art, wie wir leben, hat Auswirkungen!
Papst Franziskus betont, dass unsere Lebensweise Auswirkungen hat auf unsere Umwelt, auf das Leben in den armen Ländern und auf die künftigen Generationen. Deshalb regt der Katholikenrat an:
- Sprechen wir in unseren Kirchengemeinden, Einrichtungen und Verbänden mehr über unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung und über die Auswirkungen unseres Lebensstils weltweit, vor allem auf die Menschen, die in großer Armut leben.
- Seien wir glaubwürdig, auch beim Handeln im Einklang mit Gottes Schöpfung.
- Unser Zögern bei der Bewältigung der Klima- und Umweltkrise wird von der jungen Generation kritisch gesehen und ein Umsteuern gefordert.
- Papst Franziskus fragt in seiner Umweltenzyklika nach der generationsübergreifenden Gerechtigkeit: „Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen?“ (Laudato si´, 160)
- Gehen wir mutig Schritte zur Bewahrung der Schöpfung voran. Papst Franziskus und die Deutsche Bischofskonferenz bestärken uns darin: „Wir als Kirche haben den Anspruch, in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz mit gutem Beispiel voranzugehen. Diese Bereiche sind gelebter Schöpfungsglaube und gehören ins Zentrum kirchlichen Handelns.“ (Arbeitshilfe Nr. 301 DBK, aus dem Vorwort).
Öko+fair vor Ort
Ein Projekt im Bistum Erfurt zum Nachmachen
von Annegret Rhode
Im Juni 2021 startete im Bistum Erfurt das Projekt „öko+fair vor Ort“ mit einem Schöpfungsgottesdienst. Auf Grundlage der Enzyklika „Laudato Sí“ von Papst Franziskus und inspiriert von der „Fairen Gemeinde“ im Bistum Osnabrück, wurde die Initiative ins Leben gerufen, um Anregungen für ökologisches und faires Handeln in den Kirchorten des Bistums zu geben.
Papst Franziskus macht deutlich, dass die Sorge um die Erde untrennbar mit der Sorge um die Armen verbunden ist. Die Menschen, die am härtesten unter den Folgen der Umweltzerstörung leiden, haben am wenigsten dazu beigetragen.
„Wie wir mit den Ressourcen unserer Erde umgehen, ist keine Frage des Lebensstils, sondern eine Frage der Gerechtigkeit.“ (LS)

Diese Botschaft ist bei den Menschen angekommen. Viele Kirchorte, Verbände und Einrichtungen zeigten sich interessiert und organisierten Informationsworkshops, um mehr über das Projekt und die mögliche Umsetzung zu erfahren. Mit dem Ziel das bereits vorhandene ökologische und faire Handeln der Engagierten im Bistum Erfurt zu würdigen und auszubauen, besteht das Projekt aus mehreren Schritten:
Nach einem Informationsworkshop finden sich die Engagierten vor Ort in einer Projektgruppe zusammen und wählen aus sechs vorgeschlagenen ökologischen und fairen Kriterien jeweils drei aus, die gemeinsam umgesetzt werden. Eine Verbindlichkeit entsteht durch die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung. Sind die Kriterien umgesetzt, folgt eine feierliche Auszeichnung des Kirchortes als öko+fair. Mit der Teilnahme am Projekt sind außerdem eine Begleitung und fachliche Beratung verbunden.
Aktuell nehmen 15 ganz unterschiedliche Gruppen aus dem Bistum Erfurt am Projekt teil: Pfarreien, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Jugendgruppen und Verbände. Eine Pfarrei und zwei Altenpflegeeinrichtungen haben mittlerweile ihre selbst gewählten Ziele erreicht und ihre Auszeichnung gefeiert.

Einmal im Jahr stellen wir im Jahresbericht die vielfältigen Aktionen und Herausforderungen vor, die die Menschen erlebt haben: www.bistum-erfurt.de/oekofair
Es ermutigt und inspiriert zu sehen, wie vielfältig sich die Menschen vor Ort engagieren.
In der Fülle der Nachrichten über die weltweiten Krisen und Katastrophen brauchen wir Erzählungen, dass es anders geht. Wir brauchen Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben und den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung umsetzen, ganz konkret und bei sich vor Ort!
„Alles ist miteinander verbunden.“ Mit dem Projekt öko+fair vor Ort wollen wir auch zukünftig das Bewusstsein für die weltweite Verbundenheit aller Menschen und der gesamten Schöpfung stärken.
Die Autorin Annegret Rhode ist Referentin in der Abteilung Pastoral im Bistum Erfurt
Kontakt:
Tel.: 0361 6572-315
Mail:

„Die Welt ist mehr als ein zu lösendes Problem, sie ist ein freudiges Geheimnis.“
Der Sonnengesang und das gemeinsame Haus
von Nestor Borri
Die Enzyklika Laudato Si ist in zweifacher Hinsicht neu- und einzigartig. Zum einen wird ein in der heutigen Kultur eher selten verwendetes Genre eingesetzt: der Lobpreis („Gelobt seist du“). Das gesamte Dokument ist auf diese Dimension hin ausgerichtet, eine Art vertikale Öffnung „nach oben“, die auch den Sonnengesang durchzieht und seine einzigartige Sicht auf das Leben und den Kosmos ausmacht und ebenfalls diese Enzyklika prägt. Bedeutend ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass der Heilige aus Assisi, der den Lobgesang anstimmt, eine außergewöhnliche und starke Persönlichkeit ist. Die Enzyklika beginnt nicht mit einer Diagnose, sondern mit einem Gedicht, einem Gesang und Lobpreis. Im Mittelpunkt das Innerste, das sich berühren lässt und entfaltet. Ein vorbildliches Leben in Heiligkeit. Eine inspirierende Persönlichkeit. Als wollte man uns sagen, dass es uns nicht an politischen Strategien oder Maßnahmen mangelt, sondern dass wir vor allem Inspiration und Orientierung für den Gesang unseres Herzens benötigen.
Das zweite neuartige Element möchte ich wie folgt beschreiben: Laudato Si ist die Wirtschaftsenzyklika von Franziskus. Der Begriff des „gemeinsamen Hauses” erweitert, hinterfragt und bereichert die Umweltfrage um eine Dimension des Zusammenlebens, die wie die Herkunft der Begriffe Ökologie, Ökonomie und Ökumene zum Kern der Begrifflichkeiten vordringt und eine zentrale Orientierung für jede Betrachtung oder Strategie bietet.
Diese beiden Aspekte machen Laudato Si zu einer sehr wertvollen Orientierungshilfe für unsere Zeit, wenn wir sie als solche annehmen.
Vermutlich hätten das Lehramt der Kirche und die Zukunftseinschätzungen der vatikanischen Institutionen jedem Papst die Zweckmäßigkeit eines Dokuments zum Thema Umwelt nahegelegt. Da diese Aufgabe jedoch in die Hände von Franziskus gelegt wurde, dem Papst, der aus dem äußersten Süden, der Peripherie, praktisch vom Ende der Welt, kam, ist es nicht verwunderlich, dass die Enzyklika einen ganz eigenen Tenor und Inhalt erhielt, die der aktuellen Situation in der Welt und der Kirche Rechnung tragen.
Die Verknüpfung und zugleich Spannung sowie die fruchtbare und herausfordernde Begegnung zwischen dem „Schrei der Erde” und dem „Schrei der Armen” ist dieses „südliche”, lateinamerikanische Element, das Franziskus beiträgt, einbringt und fordert, damit Umweltschutz mehr (beziehungsweise weniger) ist als die Art und Weise, wie Ökologie normalerweise in den Ländern des Zentrums umgesetzt wird. Die zentrale Rolle der Armen und der Völker bei der Erarbeitung von Konzepten und Verfahrensweisen. Wenn es um die Entwicklung von Projekten, die Unterbreitung von Vorschlägen zu politischen Maßnahmen oder Vereinbarungen geht, ist das Thema der großen Bevölkerungsmassen, die Mehrheit der Menschheit, die auf diesem Planeten lebt, nicht „der soziale Aspekt” der Ökologie, sondern ihr eigentlicher Inhalt.
Laudato Si enthält einen zentralen Satz von Franziskus, der als eine der Grundsäulen seines Denkens angesehen werden kann: „Die Welt ist mehr als ein zu lösendes Problem, sie ist ein freudiges Geheimnis.“ Es geht darum, was die Welt ist und was sie nicht ist. Ein Spannungsfeld zwischen Problem und Geheimnis, zwischen Handeln und Freude. Damit benennt er unseren größten gemeinsamen Raum (die Welt, die unser Zuhause ist) und auch unsere Zeit. Unseren „Moment” in diesem Raum. Die Mahnung ist gut, zentral. Denn sie verweist auf seine Kritik, die sich auf die grundlegende Ebene, auf die Ebene des „Paradigmas” bezieht.
Das technokratisch-bürokratische Paradigma ist das zentrale Element der kritischen Ermahnung in Laudato Si und auch des Denkens von Franziskus. Es geht nicht nur um Kapitalismus oder Liberalismus beziehungsweise die Alternativen dazu. Denn „das Paradigmatische”, das Technische und Bürokratische, die zwei Formen der Macht darstellen, kann auch in Vorschlägen der Zivilgesellschaft, in alternativen oder emanzipatorischen, zivilgesellschaftlichen oder demokratischen Vorschlägen vorhanden sein und ist es auch. Es ist im Grunde genommen die Ökologie selbst, als ein Bereich des Denkens, der öffentlichen Politik beziehungsweise der sozialen Bewegung und als Weltanschauung, die wahrgenommen und von den technokratisch-bürokratischen Formen des Lebens in der Welt getrennt werden muss.
Vor diesem Hintergrund erhalten die Begriffe „Haus“ und „Sorge“ eine neue Bedeutung. „Oikos“ (das griechische Wort für Haus) drückt etwas aus, was kein anderer Begriff aus dem Paradigma der Wissenschaft, und auch keine Begriffe aus dem gängigen Sprachgebrauch des Aktivismus vermitteln können. Ein menschlicher, ethischer, aber auch theologischer, spiritueller und liebevoller Begriff, was Inhalt und Symbolik anbelangt. Die Erfahrung des Lebens im Haus spiegelt die Lebenswirklichkeit und eine Tiefe der Existenz wider, die für das Verständnis des Begriffs der Ökologie in Laudato Si grundlegend sind. Das Dokument ist eine praktische Anleitung, eine Orientierungshilfe für uns, was wir tun sollen, wie wir handeln und vorgehen sollen. Es durchdringt Ebenen und Strategien mit einem Bild, das nicht nur einen philosophischen Hintergrund darüber vermittelt, was Leben und Wohnen bedeutet, sondern auch eine unmittelbare Erfahrung jedes Einzelnen und jeder Gruppe, jedes Mannes und jeder Frau unserer Zeit.
In der Enzyklika finden wir auch eine Definition von Eigentum, die über den reinen Besitz hinausgeht und auf das grundlegende Streben und Bedürfnis aller Menschen nach einem eigenen Ort, nach dem Recht auf Eigentum, verweist. Aber nicht im „juristischen Sinne eines Vertrages”, sondern vor allem im Sinne des Bedürfnisses der menschlichen Seele, eines jeden einzelnen Menschen und seiner Familie, einen Ort der Wertschätzung und Geborgenheit zu haben, einen Zufluchtsort, einen Garten, den man sein Eigen nennen kann. Dieses Gefühl, das wir alle in uns selbst als Sehnsucht und Wehmut, als Freude und Entbehrung (in dieser Zeit der Umweltkatastrophen, Vertreibung und Schutzlosigkeit) erkennen können, erstreckt sich auch auf die gesamte Schöpfung. Der Planet, auf dem wir Menschen leben, schließt auch den Garten des Baumes, den Wald, die Tiere, Flüsse und sogar die Sterne ein. Das große Haus, das wir alle teilen: ein Ort des Lebens für uns, mit allen Dingen und Geschöpfen, die uns auf dieser langen Reise begleiten.
So gesehen legen Franziskus und Laudato Si auch den Finger in die Wunde, was die Definition der Rolle des Menschen im Kosmos anbelangt und die Grenzen der Wissenschaft, der Menschheit einen Ort zum Leben zu bieten. Das Reich der Dominanz und des Kalküls, das die Wissenschaft in der heutigen Zeit propagiert, ist unwirtlich. Es verlangt ständiges Handeln, erlaubt aber weder, das Erreichte zu feiern noch innezuhalten, um zu ruhen und Liebe und Wertschätzung zu erfahren. Die Menschen von heute, die als Subjekt von Wissenschaft und Technik von Zahlen beherrscht werden, zum Beispiel davon, wie viele Likes sie erhalten oder wie viel Leistung sie erbringen, und stets ihrem eigenen Spiegelbild ausgesetzt sind, brauchen auch einen Ort der Besinnung und der Muße, der Begegnung und der Ruhe. Ein Zuhause. Einen inneren Raum. Eine Innerlichkeit. Alle, die wir unseren Instagram-Account öffnen, werden früher oder später auf diese Reels stoßen, in denen die Bedeutungslosigkeit des Menschen im Vergleich zu galaktischen Entfernungen oder der Unendlichkeit der Atome dargestellt wird. Unsere Worte gehen unter Tausenden von Ausdrücken ohne Zeichensetzung und ohne Grenzen unter, und unser Bild ist nur eines unter vielen exotischen, bizarren oder „andersartigen” Bildern. Jeder Ort verliert sich in einer Flut von Bildern, die kein Spiegel sind und in denen wir uns nicht sehen können. Oder schlimmer noch: Wir sehen das Bild eines grausamen und düsteren Spiegels, in dem wir uns nur wiedererkennen, wenn wir unsere Persönlichkeit opfern oder uns verbiegen. Zu Hause sein: eine tiefe Sehnsucht der Menschheit, eines jeden Einzelnen von uns. Und auch: ein allgemeiner Mangel, der uns alle überall auf der Welt verbindet.
Die Sorge bezieht sich nicht mehr allein auf unsere „Umwelt“, sondern auch auf das gemeinsame Haus und all diejenigen, die darin leben. Die Sorge erscheint als eine Grundhaltung und Achse, nicht nur für das Handeln, sondern auch für die Ausrichtung des Lebens. Das eigene Leben, sowohl das individuelle als auch das gemeinschaftliche, als Raum und Zeit für Gesten der Fürsorge zu gestalten. Die Sorge ist weder Ziel noch Zweck. Sie lässt sich nicht messen. Sie ist Haltung, Absicht, Unmittelbarkeit.
Fürsorge ist vor allem eine Geste . Man könnte Laudato Si als Ausdruck und Zeichen einer Geste bezeichnen. Das Gleiche gilt für das gesamte Pontifikat von Franziskus. Aus dieser Perspektive, der eines Evangeliums der Gesten, verändern die Lektüre der Dokumente und die Analyse des Verlaufs seines Pontifikats die Art und Weise, wie der Ansatz des argentinischen Papstes rezipiert wird. Die Geste ist das „Symbolische im Quadrat“ beziehungsweise „die Quadratwurzel eines jeden Wortes“. In Zeiten, in denen das menschliche Wort – die wahre Heimat des Seins, wie Philosophen sagen – wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit kommerzialisiert und dem Kalkül unterworfen wird, ist die Geste ein Wunder der Berührung. Eine bedeutende Ausnahme inmitten einer Flut von Entwürfen, die, ob ökologisch oder nicht, weder den Körper eines jeden Einzelnen noch den der Menschheit berühren. Die Geste ist der Anfang. Und sie ist Autorität.
Von dem Ort aus, an dem Chance und Stärke beginnen. Die Stärke, anzufangen. Die Dringlichkeit, die Autorität zurückzugewinnen. Sich selbst zu autorisieren: sich selbst die Erlaubnis zu geben. Auch: sich selbst zu einem Subjekt zu machen. Aus diesem Grund fordert Laudato Si uns alle an unserem jeweiligen Ort heraus. Die Enzyklika greift das fordernde, aber auch liebevolle Wort Gottes an Adam und Eva im Paradies (bereits verloren, aber immer noch ein Garten) nach der Erbsünde wieder auf (d. h. am Anfang der Geschichte und des Lebens, am Anfang der Welt). Die Frage, die wie eine wütende Herausforderung erscheint, aber auch eine liebevolle Annäherung ist: Adam, wo bist du?
Wo bist du? Wo sind wir? Seinen eigenen Ort zu bestimmen, ist eine Frage der Disziplin. Laudato Si richtet sich mit einer Aufgabe und einer Einladung an alle Menschen in ihrer jeweiligen „Lebenssituation”. Nicht nur als Laien oder Geweihte, wie es früher in den kirchlichen Dokumenten hieß, sondern als Menschen in jedem nur erdenklichen Lebens- und Beziehungsumfeld: in der Familie, im Beruf, in Politik, Kultur oder in leitender Funktion. Als Mütter, Arbeitnehmende, Priester, Jugendliche, Ingenieure, Dichter, Mitarbeitende der städtischen Müllabfuhr oder Menschenrechtsaktivisten. In Berlin oder in Villa Fiorito. Als Fußballspieler, Popstars oder Kioskbetreibende.
Daher lohnt es sich, Laudato Si in enger Verbindung zu dem anderen wichtigen Dokument von Franziskus zu betrachten, der Enzyklika Fratelli Tutti: „Denkt daran, dass ihr alle Geschwister seid“. Die Tatsache, dass die Titel beider Enzykliken Zitate des Heiligen von Assisi sind, dessen Namen der Papst als bedeutendes Zeichen angenommen hat, spricht für eine Lektüre beider Dokumente. Fratelli Tutti ist vermutlich der Kern von Franziskus‘ Denken, wie es in seiner Lehre zum Ausdruck kommt. Laudato Si ist ein Lobpreis. Fratelli Tutti ist eine Erinnerung und vielleicht auch eine Ermahnung. Fratelli Tutti: Die Tatsache, dass wir alle Geschwister sind, ist die notwendige Folge der Beziehung „nach oben“, die sich im Lobpreis ausdrückt. Ihr Anliegen, ihre Konkretisierung. Ihre Forderung. Und im Untertitel dieser zweiten Enzyklika wiederholt sich diese von Franziskus oft dargestellte Spannung zwischen der „Vertikalen” der Tiefe und der Höhe und der „Waagrechten“ des Horizonts der Communio, und Barmherzigkeit. Er ruft zu Offenheit und Aufbruch auf. „Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft”, heißt es. Nicht nur die Geschwisterlichkeit, wie es in der Sprache der Moderne und des Vertragsrechts heißt, sondern auch diese unmittelbar menschliche und „heimische“ Dimension der Nachbarschaft und Erfahrung, der sozialen FREUNDSCHAFT. Die Freundschaft als liebevolle Verkörperung der Geschwisterlichkeit.
Franziskus aus Assisi und Franziskus aus Buenos Aires-Rom vermitteln eine Botschaft des Neuanfangs. „Es ist möglich, neu zu beginnen … Jeder Tag bietet uns eine neue Gelegenheit”. So beginnen die Abschnitte 77 bis 79 von Fratelli Tutti, die auch die zentrale Botschaft darstellen: Wir sind aufgefordert, zum Staunen und zum Lobpreis zurückzukehren, angesichts und inmitten der Schönheit der Welt, in der hellen Sonne aber auch im Angesicht der Schwester Tod, die am Ende unseres irdischen Lebens steht, und wir sollen den Lobpreis anstimmen.
Wir leben im Hause des Universums, das uns als Schöpfung geschenkt wurde. Wir leben auf dem Planeten, den unsere Wirtschaft als Herrschaftsgebiet bearbeitet und als Garten pflegt (unsere Sonden, unser Blick und unsere Krallen sind bereits auf die Nachbarplaneten gerichtet und erkunden sie). Wir leben in Gemeinschaften und Ländern. Wir leben in Gesellschaften, die nur gelegentlich und unter Mühen versuchen, Völker zu sein. Wir sind Teil von Völkern, die in das Kalkül einer Welt ohne Ecken und Kanten einfließen. Aber wir brauchen die Ecken und Kanten, die uns eigen sind, die uns ausmachen. Wir leben unsere Formen von Engagement und Aktivismus, kultureller und beruflicher Art, darin besteht unser Alltag. Wir leben in Gesellschaften, die zerrissen und gelähmt sind. Hektisch und unbeweglich zugleich. Letztendlich leben wir unser wahres Leben nebeneinander, isoliert voneinander oder auch nicht. Aber wir sind da. Laudato Si ruft uns dazu auf, uns an allen Orten, an denen wir leben und manchmal auch Entscheidungsträger sind, mit einem Loblied zu positionieren. Einen Moment lang in Staunen und Dankbarkeit innezuhalten. Und von dort aus mit Freude und Disziplin wieder neu anzufangen. Wenn es möglich ist, weil es möglich ist, singend.
Der Autor Nestor Borris ist Mitarbeiter der Initiative “Faktor Franziskus” und des Zentrums “Tierra Nueva” (Neue Erde) in Argentinien und Berater von Brot für die Welt und Misereor e.V.
Nestor Borri möchte mit seinen Initiativen und seinem Engagement das Denken von Papst Franziskus in den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik, Kultur und Kirche in Argentinien und ganz Lateinamerika fördern.
Laudato si’ Action Platform
Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft
von Dr. Wendelin Bücking
Laudato si’ Action Platform wurde 2021 auf Initiative von Papst Franziskus ins Leben gerufen und soll weltweit Familien, Gemeinden, Organisationen, religiöse Gemeinschaften, Pfarreien, Sozialeinrichtungen, Schulen, aber auch Unternehmen auf ihrem Weg zu einer ökologisch-sozialen Transformation im Geist der Enzyklika Laudato si’ begleiten. Die Plattform wird vom Dikasterium zur Förderung der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung des Vatikans veröffentlicht (Ein Diskasterium ist eine hochrangige vatikanische Behörde, vielleicht vergleichbar mit einem Ministerium in einem weltlichen Staat. Das zeigt den hohen Stellenwert, der im Vatikan dem Thema und auch der Enzyklika Laudato si‘ beigemessen wird). Ziel ist es, dass eine weltweite Bewegung entsteht, die die Ziele von Laudato si‘ verfolgt und auch im aktiven praktischen Tun umsetzt.
Die Plattform verfolgt sieben Leitziele, die sich an den Prinzipien der integralen Ökologie orientieren und Teilnehmer durch eine Reise der ökologischen Umkehr führen.
Die sieben Ziele im Überblick
Ziel 1: Reaktion auf das Weinen der Erde
Natürliche Lebensräume schützen, Biodiversität bewahren und Emissionen reduzieren.
Ziel 2: Reaktion auf das Weinen der Armen
Soziale Ungleichheiten abbauen, Zugang zu sauberem Wasser und grundlegenden Gütern sichern.
Ziel 3: Ökologische Ökonomie
Ressourcen schonen, Kreislaufwirtschaft fördern und globale Lieferketten gerecht gestalten.
Ziel 4: Förderung nachhaltiger Lebensstile
Konsummuster kritisch hinterfragen, Mobilität, Ernährung und Energieverbrauch klimafreundlich gestalten.
Ziel 5: Ökologische Bildung
Umwelt- und Schöpfungsthemen schulisch und außerschulisch verankern, generationsübergreifendes Lernen stärken.
Ziel 6: Ökologische Spiritualität
Dankbarkeit, Achtsamkeit und spirituelle Verbundenheit mit der Schöpfung kultivieren.
Ziel 7: Gemeinschaftliches Engagement
Lokale Initiativen stärken, partizipative Entscheidungsprozesse fördern und Netzwerke aufbauen.
Sie stellen ein klares Rahmenwerk zur Verfügung, in dem wirkungsvolle Maßnahmen identifiziert und priorisiert werden, und ermöglicht Institutionen, ihre Fortschritte zu dokumentieren und mit einem Zertifikat öffentlich zu feiern.
Der Einstieg erfolgt über eine freiwillige Anmeldung, gefolgt von einem öffentlichen Bekenntnis zu den Zielen und einer ersten Reflexion über persönliche Werte und Lebensstile. Anschließend wählt man aus einer Liste maßgeschneiderter Handlungen mit hohem Impact aus und erstellt innerhalb des ersten Jahres einen konkreten Laudato si’-Plan. Jahr für Jahr werden der Plan aktualisiert, eigene Maßnahmen evaluiert und gegebenenfalls finanzielle Mittel bereitgestellt, um abschließend ein Teilnahmezertifikat zu erhalten.
Mit der Laudato si’ Action Platform entsteht ein dynamisches Netzwerk, das Umweltbewusstsein, soziale Gerechtigkeit und spirituelle Dimensionen verbindet. Sie ist mehr als ein Instrument zur CO2-Reduktion oder Ressourcenschonung, denn sie fördert eine Kultur der Achtsamkeit und Solidarität. Als sichtbarer Ausdruck globaler Zusammenarbeit kann die Plattform langfristig einen direkten Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigen und gerechten Welt leisten.
Leider ist die Plattform bisher im deutschen Sprachraum nicht rezipiert worden, auch ist bisher keine deutsche Übersetzung vorhanden. Das Konzept ist wie ein Management-System aufgebaut, man könnte die Plattform zum Beispiel nutzen, um in ein Umweltmanagementsystem einzusteigen, das man dann weiter ausbauen kann. Umfassendes Arbeitsmaterial und Anleitungen werden auf der Webseite bereit gestellt und könnten mehr genutzt werden und Beachtung finden, bis dahin gehend, dass man sich quasi ein „Laudato si‘-Siegel “ verleihen lassen kann.
Im deutschen Sprachraum gibt es bereits mehrere solcher Einstiegsmöglichkeiten in ein Managementsystem, wie z. B. die „Öko-faire Gemeinde“. Vielleicht ist es auch deshalb schwierig, für die Laudato si‘-Plattform hier Fuß zu fassen.
Die Laudato si‘-Plattform ist jedoch mit höchster Autorität ausgestattet und hat auch eine weltweite Bewegung im Blick. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die vielen kleinen Initiativen zu bündeln, und ein einheitliches, katholisches Handlungs- und Berichtstool zu schaffen. Das wäre charmant. Vielleicht gibt es bald eine Initiative für eine deutsche Übersetzung.
https://laudatosiactionplatform.org
Darüber hinaus gibt es auch eine Laudato si‘-Movement-Plattform. Hier geht es mehr um kirchliche Organisationen, die in der globalen Gerechtigkeit unterwegs sind und ihren Zielen, Kampagnen und Aktionen. Auch diese Plattform versteht sich als globales Netzwerk, dient dabei aber eher der Vernetzung und nicht als Anleitung zu konkretem Handeln vor Ort im Sinn von konkreten Plänen und einem Managementsystem. Auch diese Plattform ist eine Beachtung wert, vor allem um auch den Blick von unserer deutschen Umweltbewegung auf andere globale Aktionen und Initiativen zu weiten. Die Plattform ist amerikanisch geprägt und leider gibt es auch hier keine deutsche Übersetzung.

Gebet für unsere Erde
Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
Schlussgebet aus der Enzyklika „Laudato si´ – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ (2015)
von Papst Franziskus
Unterstützen:
Die Redaktion wird von einem Förderverein unterstützt.
Unterstützen Sie die Herstellung und dn Versand der BRIEFE mit einer Online-Spende bei der KD-Bank:

